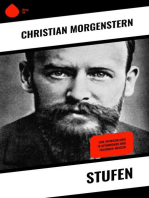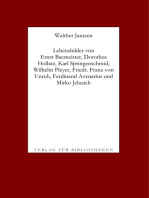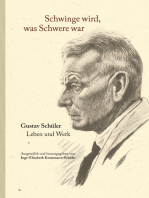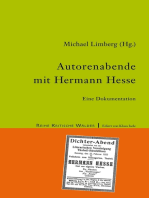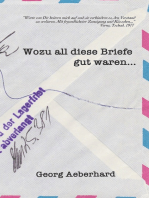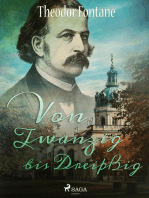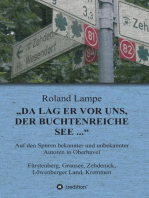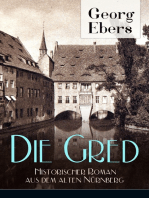Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Zelter, Carl Friedrich - Darstellungen Seines Lebens
Cargado por
Wilhelm KügelgenDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Zelter, Carl Friedrich - Darstellungen Seines Lebens
Cargado por
Wilhelm KügelgenCopyright:
Formatos disponibles
Carl Friedrich Zelter Darstellungen seines Lebens 1. Kurzer Lebenslauf. [3] Ich bin im Jahr 1758 am 11.
Dezember zu Berlin geboren. Mein Vater, ein Sach se, aus einem Dorfe bei Dresden gebrtig, lie mich in meinen Kinder- und Jnglingsjah ren in verschiedenen angenehmen und ntzlichen Kenntnissen unterrichten. Bis an me in siebzehntes Jahr besuchteich das Joachimsthalsche Gymnasium und hierauf kam i ch in die Lehre, um meines Vaters Gewerbe, die Maurerprofession, zu erlernen. Bi sher hatte ich wenig Luft zur Musik, und bei dem Unterricht, den ich durch einen hiesigen Organisten im Klavier- und Orgelspielen erhielt, wenig Aufmerksamkeitu nd Anlagezu dieser Kunst bewiesen. Nach einer im achtzehnten Jahreberstandenen sc hweren Krankheit, die mich beinahe ins Grab legte, erwachte eine groe Liebe zur M usik in mir; da aber jetzt die Erlernung meiner Handwerksgeschfte alle meine Zeit erforderte, so blieb mir nur derspte Abend brig, meinem Durst nach Musik zu gengen . Ich brachte viele Nchte mit Notenschreiben zu und um mir einige Fertigkeit im K lavier- und Violinspielen zu erwerben, allein diese Freude dauerte nicht lange. Der Musikmeister mute andern Lehrstunden seinen Platz lassen, und mein Vater unte rsagte mir daneben noch meine zu groe Ttigkeit in der Musik, weil er frchtete, das Nachtwachen knnte meiner Gesundheit nachteilig werden. Dies alles hielt mich inde ssen nicht ab, in der Musik fortzurcken, und ich fing an, da es mir an Musikalien gebrach, selbst zu komponieren. (Ein seines Mittel, sich aus der Verlegenheit [ 4] zu ziehen.) Ich hatte dabei keine Regel als das absolute Bedrfnis, meine Gedan ken zu Papier zu bringen, wobei es mir dann alle Augenblicke an den ntigen Kompos itionskenntnissen fehlen mute. Da ich keine Bekanntschaft mit wissenschaftlichen Musikern hatte, so nahm ich meine Zuflucht dazu, mir teils durch Freunde, teils durch List Partituren zu verschaffen, die ich mir abschrieb. Ich war so glcklich, gleich im Anfange einige Partituren von Carl Philipp Emanuel Bach und Hasse zu bekommen. Durch das Studium dieser Meister lernte ich zuerst zwei wesentliche Ei genschaften guter Kunstwerke Ordnung und Einheit kennen. Dadurch gewann ich eine Art von Fertigkeit, meinen Gedanken Leichtigkeit und meinen Mittelstimmen einig en Flu zu geben. Hier fing meine Gesundheit an, durch anhaltenden Flei und durch m anchen kleinen Kummer, den meine Anhnglichkeit an die Musik zuwege brachte, in Un ordnung zu geraten. Ich hatte keinen Gedanken mehr als an die Musik, alles ander e flog meinen Sinnen vorber; nur allein die Musik lie feste Eindrcke bei mir zurck, die meine ganze Seele fllten. Meine Modelle, Bach und Hasse, waren meine Gottheit ; zu diesen betete ich, fr diese arbeitete ich, litt ich; mit diesen trstete ich m ich. Mein Vater erweckte mich aus dieser Schwrmerei durch den Befehl, die Musik fr jetzt ganz beiseite zu legen. Die Geschfte, meinte er, wrden darber versumt und die Gesundheit zerstrt; Musik sei eine Sache, von der man kein Brot essen, mit der m an keine Krankheiten heilen knnte. Der Geschmack an den schnen Knsten beruhe auf krp erlicher Gesundheit und sorgenfreier Existenz etc. Diesen ernsthaften Vorstellun gen wute ich nichts entgegenzusetzen als willigen Gehorsam. Ich versprach, mich z u [5] bessern, schlief etwas mehr und war treuer in meinen Berufsgeschften, allei n nach vier Wochen ward alles wieder beim alten. Genug, ich tat, was in meinem V ermgen war; ich lernte mein Handwerk, meine Geometrie, ging in meine Zeichenstund en und trieb dabei meine geliebte Musik mit aller Kraft, die mir brig war. Im Jah r 1783 wurde ich auf mein Handwerk Meister. Nach dieser Zeit erst war der Kniglic he Kammermusikus Herr Fasch so gtig, mir den eigentlichen Unterricht im reinen Sa tz und im doppelten Kontrapunkt mitzuteilen, und ich habe diesen vortrefflichen Unterricht so gut gentzt, als es sich bei meinen vielen andern Geschften hat wolle n tun lassen. Diesem wrdigen Herren Fasch habe ich das Gute, was manche meiner Ko mpositionen haben mgen, gnzlich zu danken. Sein seiner kritischer Geist, sein scha rfes, durch vieljhrigen Unterricht gebtes Auge, sein redlicher, freimtiger und anstn diger Tadel, sein seltenes und miges Lob und die mir unaussprechlich werte vterlich e Liebe, die dieser edle Mann mir geschenkt hat, haben mir mehr Nutzen in kurzer Zeit gestiftet als vorher mein langes und eifriges Suchen und alles Lesen selbs t in den besten Lehrbchern.
Was ich bis jetzt komponiert habe, besteht in drei kleinen Werken, Variationen be r drei verschiedene Thema ta und einer Klaviersonate, die in Berlin bei Herrn Rells tab gedruckt sind; ferner in einer nicht geringen Anzahl von kleinen Liedern, wo von die besten in verschiedenen Werken zerstreut abgedruckt sind. Allein selbst diese besten sind nicht von besonderm Wert, weil mir diese Art von Kompositionen niemals recht hat gelingen wollen. Sie sind meistenteils auf Ansuchen meiner Fr eunde oder besondere Gelegenheiten gemacht. Innern [6] Drang zu dieser Art von K ompositionen hab' ich nie gehabt. Auerdem habe ich einige Gelegenheitsmusiken gem acht. Die besten darunter sind: eine Kantate auf den Tod Friedrichs des IIten im Jahr 1786, und eine Kantate auf den Geburtstag einer geliebten Mutter im Jahr 1 793 komponiert. Eine Menge einzelner Arien und Szenen von mir kommen nicht in Be trachtung. Das Bratschenkonzert, dessen im Gerberschen Lexikon gedacht wird, hab e ich vor dreizehn Jahren gemacht, und wenn es auch einige Spuren von Geist hat, so hat es dagegen viele Fehler und ist nicht im Satz rein. Alle meine brigen mus ikalischen Arbeiten sind Studien, die in figurierten Chorlen und Fughetten besteh n, die ich niemals des Aufbewahrens wert gehalten habe. Sollte knftig meine Exist enz sich einmal dahin abndern, da ich meiner geliebten Kunst mehrere Zeit zu opfer n imstande bin, so hoffe ich, die Freunde meiner Muse fr diejenigen meiner Arbeit en zu entschdigen, die aus bereilung oder ohne meine Schuld ins Publikum gekommen sind. Berlin, den 1. November 1793. Carl Friedrich Zelter.
2. Erste Niederschrift der Selbstbiographie. [7] Schon in sehr frher Jugend hat das Lesen der Bibel und alter Chroniken die Lu ft in mir erweckt, etwas zu tun, das der Aufzeichnung wrdig wre. Besondere Veranlassung, manches aus meinem Leben niederzuschreiben, ward mir dur ch die Frau Herzogin-Mutter Amalia von Weimar, indem ich im Jahre 1802 dieser ve rehrten Frstin manches aus frhern Jahren hatte erzhlen sollen, da sie behauptete, j edermann sei verbunden, sein Leben schriftlich, wenn auch nur fr sich selbst, zu rekapitulieren. Das Papier sei eigentlich nur dazu erfunden. Wie ich nun Gesehnes und Geschehenes niederzuschreiben gedenke, nimmt es eine ph antastische Gestalt an; die Umrisse verlieren sich in Raum und Zeit, ich selber erscheine fast ein anderer; und doch will es getan sein. Da ich mich nun fr jetzt keines andern Zwecks bewut bin als mir eine Mue zu erheite rn, die mir ein schweres Doppelleid auflegt, indem ich den Fall meines Vaterland es betraure, das, von lang gewohnter Ehre herabgesetzt, sich unter der Prfungshan d beugt, die es verkennt; da ich eben den Tod der sen Begleiterin meines Lebens be weine und statt ihrer den fremden Feind in meinem Hause walten sehe; so schaue z urck, mein Geist, in die Tage der Jugend und sage dir noch einmal, was du sahst, und wie dir war. Ist doch die Welt nur da, insofern du es bist. Berlin, 2. September 1808. Z. [8] Im Jahre 1758, am 11. Dezember, whrend des Siebenjhrigen Krieges, in Berlin, i n dem Hause, wo ich dieses schreibe, bin ich geboren. Mein Vater war eines Schanzgrbers Sohn aus dem Dorfe Grorhrsdorf nahe bei Dresden. Sein frhester Trieb war, etwas Bedeutenderes zu lernen als Schanzen.
In seinem zehnten Jahre las er seinem Vater einst ein gedrucktes Blatt vor; dari n machte ein Advokat aus Dresden bekannt, da er einen Knaben zum Schreiben suche. Den folgenden Sonntag ging der junge Bursche nach Dresden zum Advokaten und bot seine Dienste an. Seine Person gefiel. Der Advokat befahl ihm, etwas niederzusc hreiben, das er ihm vorsagen werde; der Knabe aber gab zu erkennen, da er noch ni cht schreiben knne und gehofft habe, es hier zu erlernen. So sonderbar dem Advoka ten die Sache vorkam, so mute sie ihn doch reizen; er nahm den Knaben zu sich, un d in kurzer Zeit war dieser brauchbar und diente seinem Wohltter sieben Jahre, de r ihn endlich ungern fahren lie, da der Jngling sich entschlossen hatte, ein Handw erk zu erlernen. Er ward ein Maurer, kam als Gesell nach Berlin, wo er bei den E ltern meiner Mutter wohnte, in seinem achtundzwanzigsten Jahre hier zu Berlin Me ister wurde, meine Mutter heiratete, und ich war der letzte Sohn aus dieser Ehe. Meine Kinderjahre verflossen, ohne da mein Vater, der ein geschftiges Leben fhrte, viel auf mich zu merken schien. Desto eifriger war meine Mutter, mich von frher J ugend an schne biblische Sprche zu lehren und mir eine strenge Schamhaftigkeit als die Tugend aller Tugenden zu preisen. (Es war das Jahr 1763. Der Siebenjhrige Kr ieg war zu Ende.) [9] Spterhin ward ich nach und nach dreien Hauslehrern bergeben, von denen ich Les en, Schreiben, Lateinisch und dergleichen lernen sollte, was mir alles sehr glei chgltig war, da eine gute Gesundheit und Bewegsamkeit meines Krpers mich an die fr eie Luft und zu den Spielen der andern Knaben hinzogen. Da ich immer sitzen und lernen sollte, so lief ich immer davon und ward immer gesucht, gescholten und au ch wohl geschlagen. In Absicht auf Musik kann ich mir aus dieser stumpfen Periode nur erinnern, da ei ne kleine Violine, welche mir etwa im achten Jahre der Weihnachten brachte, viel Freude gemacht und mich anhaltender beschftigt hat als andere Kindereien; ich ma chte mir selber Noten nach meiner Art und tat, als wenn ich darnach spielte. Im zehnten Jahre baute ich mir im Garten eine Orgel aus kleinen Latten und Bretterw erk; auf das Pedal wendete ich besondern Flei, da es ordentlich konnte getreten we rden, und auch hierbei verharrete ich den ganzen Sommer. Auerdem tat ich gern, wa s mir eben gefiel, insofern dadurch meine Lebhaftigkeit unterhalten wurde. Einen natrlichen Widerwillen aber hatte ich gegen alles Handwerk und das wiederkehrend e Einerlei desselben, von dem ich tglich, ja stndlich umgeben war, denn meine Mutt er selber bekmmerte sich sehr ttig um die Geschfte meines Vaters; und so mute ich wo hl glauben, was so oft gesagt und besttigt wurde: da nur Handwerk gldnen Boden habe ; da Handwerk ber alles gehe, besonders ber hohen Stand und herrschaftliche Abhngigk eit. Handwerk knne wohl sinken, niemals aber ertrinken; der Handwerker sei der wa hre Brger; das Gesetz, was ihn binde, beschtze ihn; die Mitte, wo er stehe, bewahr e ihn; da er berall gebraucht[10] werde, sei er frei; Ehre und Wert stehen im gen austen Verhltnis; Schande und Erniedrigung seien ihm ganz fremd. Was ich gegen diese gute Theorie allenfalls einwenden konnte, wurde von meiner M utter auf der Stelle ausfhrlich widerlegt; doch zu einem Maurer, der ich doch wer den sollte, hatte ich wenig Luft. Was meine Mutter wohl eher htte gelten lassen, wre gewesen, einen ihrer Shne im Dienste Gottes, das ist: auf der Kanzel zu sehn; aber diese Hoffnung schien vereitelt, weil mein lterer Bruder, den sie ber alles g eliebt hatte, gestorben war. Dieser war ein so frommer, lieber Sohn gewesen, da s ie geglaubt hatte, er mte zu etwas ganz Besonderm von der Vorsehung bestimmt sein, wozu sie dann das ihrige beizutragen habe. Ich wre nach ihrer Meinung viel zu le bhaft und leichtsinnig, um etwas anderes als einen durch bestimmte Ttigkeit gebun denen Weltmann an mir zu erziehn. [An mutwilligen Spen, die eine gute Gesundheit und Trieb zu allerlei Kraftuerungen v errieten, lie ich's nun nicht fehlen. So ward ich einst, etwa im sechsten Jahre, als ich mich ungehorsam bezeigt hatte, von der Muhme, die meiner Mutter Schweste r war, verurteilt, whrend der Mahlzeit in der andern Stube an einen groen Lehnstuh
l festgebunden zu sein. Eine Weile hielt ich ruhig aus, bis mich der Geruch der Speisen aus der Fassung brachte. Mit Ungeduld sprang ich, meiner Fesseln uneinge denk, vom Stuhl, ri den Stuhl mit mir, und da der eine Fu desselben sich mit dem F ue eines danebenstehenden Kaffeetisches durchstand, so lag augenblicklich das auf dem Tische befindlich gewesene Porzellan auf der Erde. Alles sprang vom Tische auf, mir [11] entgegen. Mein Vater allein blieb sitzen und lachte. Meine Mutter schalt die Tante heftig ber diese Anbinderei, und ob ich gleich einige Schlge beka m, so war ich doch in mir so vergngt ber den Wischer, welchen die Tante davongetra gen hatte, als wenn ich aufs beste gegessen htte. Die Muhme bezeigte sich zufolge ihrer Maximen widerwrtig gegen meine besondern Neigungen, versteckte mir meine S pielsachen, Peitschen, Blle und andere Dinge, die ich mir selber zu verschaffen s uchte. Dagegen rchte ich mich durch allerlei Possen, welche ich ihr wieder spielt e. Es war Weihnachten gewesen, und unser Hauslehrer hatte die Tante mit allerlei Kleinigkeiten beschenkt, worunter auch eine Maus von Wachs war, welche sie sehr wert hielt und mich damit fter erschreckte, weil ich mich besonders furchtsam ge gen diese Art Tiere bezeigte. Als die Tante einst in der Kche Seife kochte, nahm ich die Maus und setzte sie unter dem Fenster an die Erde, wo eine kleine ffnung in der Diele war, und rief sachte die Tante, es sei eine Maus in der Stube. Sogl eich kam sie mit der Seifkelle und schlug auf ihre Maus, da solche in hundert Stck e flog. Als sie sich nun betrogen sahe, rannte ich zur Gromutter, deren Tochter s ie war, die mich denn gegen sie in Schutz nahm, wie sie mich mit der Seifkelle v erfolgte. Unter dem Wortwechsel war ihr die Seife angebrannt, worber sie denn wie der von meiner Mutter gescholten wurde, welches mich hchlich freute. Es war geschlachtet worden, und die Tante kochte in der Kche Wurst. Sie wollte mi r ihr Wohlwollen bezeigen und machte mich zum Hter des Wurstkessels, bei dem sie ab und zu ging, indem sie mir nicht trauete, welches ich wohl merkte. Um meinen Appetit zu stillen, [12] hatte ich bald Wrste genug gegessen; doch um ihr Mitrauen zu bestrafen, a ich noch so viel, da mir bel davon ward. Meine Mutter fand bald di e Ursache; ich erhielt Ohrfeigen und die Tante ihre gehrige Schelte. Ich hatte ab er weit mehr Wrste genommen und sie in eine Schublade einstweilen hingelegt, wori n die Tante Weizeug hatte. Doch dachte ich nicht wieder daran. Lange nachher entd eckte meine Mutter diese Wrste und bezichtete die unschuldige Tante der Untreue. Dies war mir denn doch zu arg, und ich bekannte, da ich die Wrste verborgen htte, u m sie fr ihr Mitrauen zu bestrafen. Das Spahafteste bei der Sache war endlich, da de r Geruch der Wrste kaum noch zu vertilgen war; die ganze Lade mute fter gewaschen u nd gebrht werden, welches ich mit Vergngen zusahe. Unser Hauslehrer, von dem die Tante ihre Erziehungsgrundstze zu haben schien, war mir nicht gnstiger; wenigstens hatte er bestndig zu klagen. Ich bewohnte mit ihm eine Stube nach dem Hofe zu, ber unserer Estube. Als ich einst meine Lektion nicht gelernt hatte, ging der Hauslehrer allein zum Essen, indem er mich einschlo und versicherte, ich wrde nicht eher zu essen kriegen, bis ich die Lektion wte. So war ich denn allein, indem unten gespeist wurde. Ich versuchte zu lernen, doch der H unger plagte mich; es wollte nicht gehn. In meiner Schlafkammer war in der Decke eine ffnung nach dem Dachboden, und auf diesem Boden war die Fruchtkammer. Diese s Umstandes erinnerte ich mich jetzt lebhaft. Schon hatte ich immer die Katzen b eneidet, welche ich vom Hofe aus hatte durch eine Dachluke frei aus- und eingehn sehen. Ich ging in die Kammer. Eine Leiter war nicht da, und wie sollte ich hin aufkommen? [13] Indem fiel mir ein Ende einer herunterhngenden Hausleine in die A ugen. Ich holte den Krckstock des Hauslehrers, um die Leine herabzuziehen. Die Le ine reichte aber nicht weiter bis etwa vier Fu vom Fuboden. Ich holte einen Stuhl, befestigte die Leine an dessen Lehne. Dann holte ich ein Stck Holz, stellte mich kurz, in einer Viertels auf den Stuhl und knebelte die Leine, bis sie sich hob, tunde und mit gewaltiger Anstrengung war ich oben und in der Fruchtkammer. Ich a ganz erhitzt unverhltnismig viel kalter Frchte und lie mich dann wieder herab. Nun wa r ich satt, stopfte mir eine von des Lehrers Tabakspfeifen, rauchte und setzte m ich wieder, um zu lernen. Die Geschichte whrte nicht lange. Mir ward bel, und in d er Geschwindigkeit konnte ich nur das Fenster aufreien, und aus demselben auf den Hof ging eine so starke Ausleerung vor, als ich viele kalte Apfel und Birnen ge
gessen hatte. Nun war aber auch alles verraten. Die Passage ging vor dem Fenster der Estube vorbei, und die ganze Tischgesellschaft erschien nach und nach. Erst die Tante und der Hofmeister, dann die Mutter und Schwestern. Nur mein Vater bli eb am Tische und erlustigte sich ber die Erziehungsweise des Lehrers und der Tant e. Ich ward in ein Bett gebracht und mit Tee versorgt, und am andern Morgen lern te ich meine Lektion. Ich erinnere mich dieser Kindereien deswegen gern, weil sie mir den Abstand verg egenwrtigen meines Naturells gegen das traurige Leben, welches mir als Bestimmung nachher angewiesen worden. Von der liberalen Gesinnung meines Vaters war alles zu verlangen, was mir dienen konnte, wenn dieser sonst wohlmeinende Hauslehrer e igentlichen Begriff mit seinem Amte zu [14] verbinden gewut htte. Er war ein junge r Theolog, arbeitete bestndig an seinen Predigten und las solche abends bei uns v or. Mein Vater fhrte ein geschftiges Leben, die Mutter hatte vollauf zu tun, wobei sie die Schwestern erzog. So war ich allein der Willkr zweier Personen berlassen, die mich mehr verwirrten als erbauten, wenn ich ihnen auch weiter nicht abgenei gt war.] Meine beiden ltern Schwestern lernten in dieser Zeit das Klavierspielen. Der Meis ter war ein Organist und zugleich ein ernsthafter, angenehmer Freund meines Vate rs. Dieser sollte auch mich in der Musik unterrichten, wozu ich anfnglich Luft be zeigte; allein mit mir wollte nichts werden, obgleich meine Schwestern darinne v orrckten, besonders Luise, die ltere, welche ich sehr liebte. Desto lebhafter bewe gte sich mein Krper in allen jugendlichen Abschweifungen; und wenn der Organist k am, mich zu unterrichten, so mute ich immer erst lange gesucht werden, auf den Sp ielpltzen und berall, wo ich nicht sein sollte. Mein Vater hatte zwei Ziegelscheunen nicht weit hinter Potsdam gepachtet, wohin er jahraus, jahrein reisete und mich fter mit dahin nahm. Hier war freie Luft, of fnes Feld, Berge und Seen. Ich lernte hier Bume besteigen, auf Ochsen und Khen rei ten; ich fischte, ging auf Schlittschuhen und war hier immer sehr gern. Eines Ta ges angelte ich aus einem Fischerkahne auf dem See daselbst, welcher der Schwiel ow heit. Es kam Wind, das Gewsser ward unruhig und bewegte den Kahn, welcher, ohne da ich es bemerkte, vom Ufer losging, und mit eins befand ich mich mitten unter den hohen Wellen. Der See war als falsch bekannt, hatte Untiefen, und im kleinen Kahne war nicht einmal [15] ein Ruder. Der Wind ward strker, die Wellen schlugen gewaltig, und ich war in Gefahr. Nun setzte ich mich reitend auf die Spitze des Kahns und ruderte mit den Fen zuletzt geschickt genug, um dem Ufer wieder nher zu kommen. Unterdessen war es Abend geworden, man hatte mich gesucht, und ein Knech t sagte meiner Mutter, er habe mich auf dem Schwielow angeln sehn. Hier kam nun meine Mutter, und als sie mich schon von fern auf dem See arbeiten sah, schrie s ie in der entsetzlichen Angst ihres Herzens so sehr, da ich es bald nur zu gut hrt e; denn hatte mich das Wasser nicht bang gemacht, so war es nun die Angst meiner Mutter und die Strafpredigt, welche ich erwartete. Sie rief Leute, die mich ret ten sollten, und brachte alles in Bewegung. Ich verdoppelte meine Krfte, und da i ch erst das seichte Wasser erreicht hatte, sprang ich aus dem Kahn, den ich nach mir zog, ehe die Hilfe anlangte. Ich erhielt nun eine mige Tracht Schlge und mute v ersprechen, nie wieder allein nach dem Schwielow zu gehn, obgleich die andern Le ute meine Entschlossenheit lobten, der aufgeregten Flut mit meinen Fen so krftig wi derstanden zu haben. Meine Mutter aber war von dem Schrecken einige Tage krank, welches mir am meisten wehe tat, denn die Geschichte selbst hatte mir eher Mut a ls Reue nachgelassen. Da mein Vater die Reise nach Potsdam fast wchentlich machte, so ward er mit mehre rn Musikern des Knigs bekannt, indem er solche, wenn sie den Dienst in Potsdam ha tten, mit in seinem Wagen hin oder zurck fuhr. Diese Leute fhrten mich zur Erkennt lichkeit fr diesen Dienst um die Karnevalszeit in die Knigliche Oper, wo ich einen Nebenplatz im Orchester einnahm. [16] Ich mochte eilf oder zwlf Jahre alt sein, als ich die erste italienische Ope
r sahe: es war die Oper Phaeton. Der Eindruck dieses Schauspiels war von besondere r Wirkung auf mein kindisches Gemt. Da ich von Opernarien meiner Schwestern und a ndern Klavierstcken her die Musik ganz anders kannte, als ich sie hier fand, so w ar ich sehr berrascht. Die groen, krftigen Tonmassen erregten weit mehr als das Mel odische und Formelle der Arien meine Aufmerksamkeit. Den Ton der Snger sahe ich g leichsam kommen, doch das Orchester im ganzen war mir ein ungeheures, angenehmes Rtsel. Ich war mitten unter den Musikern, von denen jeder ein Instrument spielte , und doch hrte ich nicht eins, sondern das Orchester selber, welches ich mir wie einen bezauberten Kasten, wie eine Art von Orgel vorstellte, tnte und klang als ein Ganzes in mir wider. Von dieser Betrachtung ab ward mein Blick auf das Theat er gelockt, und ich schwamm in einem Meere von Freuden. Darber wurden mir nun jene Flgelstckchen vllig zum Ekel; ich hatte Luft an der Musik , aber ich kam nicht vorwrts und geriet darber gnzlich in Verwirrung. Nur nach der Oper waren alle meine Sinne gerichtet, sonst dachte ich, fhlte ich nichts als die Leere nach Endigung des Karnavals. War mir gleich die fremde Sprache nicht bekannt, so wute ich mir alles auf das ge naueste nach meiner Art zu erklren und zu erinnern, so wie auch die Haltung und G arnitur des ganzen Hauses vor Aufgang des Vorhangs: Das Opernhaus war an den bestellten Tagen bei guter Zeit von Zuschauern angefllt und das gewhnliche dumpfe Gerusch einer versammelten Menge hrbar. [17] Das Orcheste r versammelte sich still; jeder stimmte leise sein Instrument und legte es unter dessen von sich. Die Bhne ward noch einmal gefegt. Die Generalitt erschien im Park ett, und der Hof nebst dem Adel im ersten Range der Logen. Um sechs Uhr kam der Knig. Seine Ankunft ward dadurch kund, da ein Kammerhusar mit zwei Armleuchtern ne ben dem Orchester ins Parterre trat und Trompeten ertnten. Diese Trompeten, sechz ehn an der Zahl, waren in zwei Chren einander gegenber im obersten Range der Logen d icht am Proszenio aufgestellt, auf jeder Seite acht Trompeten und ein Paar Pauke n. Erst lieen sie sich wechselsweise durch Fanfaren und Aufzge, und zuletzt alle z usammen hren. Unterdessen trat der Knig ins Parterre, verneigte sich zuerst gegen den ersten Ra ng, wo die Knigin und der hohe Adel war, nahm ein Fernglas und sah berall umher, d ann verneigte er sich gegen die Generalitt um ihn her und setzte sich endlich auf einen gepolsterten Stuhl hinter dem Kapellmeister, etwa sechs Schritte vom Orch ester. Nun hrten die Trompeten auf, es war eine allgemeine erwartende Stille; das Ohr war von dem ehernen Schalle der kriegerischen Tne gereinigt, gerieben, gerei zt: so fing die Sinfonie an, wozu selten oder niemals Pauken und Trompeten sein durften. Der Eindruck der Sinfonie unmittelbar auf dem Geschrei so vieler Trompeten mute a llerdings schwach sein; da jedoch die Sinfonie kein absoluter Teil des Stcks war, als insofern das Drama einen Anfang haben mute, so ward von der Sinfonie auch ni chts weiter verlangt, als da sie dem Drama vorangehn sollte, das nur mit dem Aufz uge des Vorhanges seinen Anfang nahm. [18] Die schnen Dekorationen eines Bibiena und Gagliari, die reizenden Tnze zwisch en den Akten, ja selbst die groen, prchtigen Reifrcke der Sngerinnen und Tnzerinnen w ie die rmischen Kleider und griechischen Gewnder machten mir alles gro und wrdig. Die italienische und berhaupt eine fremde Sprache schien mir notwendig, ja natrlic h zur Darstellung so wunderbarer Dinge. Daher kam es mir denn niemals unschickli ch vor, Helden singend sterben zu sehn, wogegen ich oft genug die Einwendungen d er damaligen Kritik anhrte. Und indem ich dem Wunderbaren seine eigene Natur zuge stand, konnte es mich vielmehr erschrecken, wenn ich an den Schauspielern Ausdru cksarten oder Bewegungen wahrnahm, die das Untergeordnete, Alltgliche verrieten. In sptern Jahren habe ich mich dessen immer erinnert, wenn ich hrte, da Friedrich d
er Groe auf seinen Bhnen durchaus keine anderen als auslndische Subjekte angestellt wissen wollte, und fand seine Meinung hierinne ganz grndlich. Das Theater war mir nun dadurch gleichsam notwendig geworden, und da um diese Ze it auch das deutsche Theater angefangen hatte, Singspiele aufzufhren, so verschaf fte ich mir die Gelegenheit, die erste deutsche Oper zu hren. Es war Der lustige S chuster von Standfu. Der Eindruck dieser Oper war mir jedoch durchaus widerwrtig un d ward es immer mehr, als der allgemeine Beifall diese Art der Opern rechtfertig en mute. Dagegen hatte nun die italienische Opera buffa, welche der Knig unterhielte, eine n groen Reiz fr mich; ich konnte mich lange hinterher an Possen ergtzen [19] und so lche nachahmen, auf meine Art auslegen und erzhlen, die ich blo durch die eigne Mo dulation des Ausdrucks und krperliche Bewegungen der Bouffons zu verstehen glaubt e. Wenn ein solcher Mensch nur nach seinem Hute griff, an den Fingern zhlte, wenn er stand, ging, sprach oder schwieg, alles, und selbst die Erinnerung brachte m ich zum Lachen. Ich ging in das vierzehnte Jahr, als mein letzter Hofmeister starb. Er war schwi ndschtig gewesen und hatte seinen groen rger mit mir, indem er verlangte, da ich so wie er in einer dunkeln Stube sitzen sollte, denn er konnte das helle Licht nich t ertragen. Nach dem Tode dieses jungen Mannes schickte mich mein Vater ins Gymnasium. Um zu wissen, in welche Klasse ich gehre, mute ich tentiert werden. Es fand sich, da ich nichts wute; einige lateinische Wrter und Regeln waren meine ganze Gelehrsamkeit, aber stark war ich, gesund und voller Saft und guten Willen. [Einen hohen Baum besteigen, einen Ball bis an die Wolken schlagen, ein Pferd umklammern, da ihm de r Odem kurz ward, und allerlei Knste auf Schlittschuhen machen, das konnte ich wi e einer.] Die neue Schule war mir aber willkommen der Freiheit wegen. Wenn ich bei meinen Hauslehrern hatte im grnen kalmanknen Schlafrock den Tag ber sitzen sollen, so kon nte ich mich jetzt am frhen Morgen fertig ankleiden. Ich hatte bestimmt zu lernen fr jeden Tag, die frhliche Gesellschaft der Jugend, den Genu der freien Luft, und brauchte nicht davonzulaufen und nachher zu lgen, wo ich nicht gewesen war. Es wa ren sieben Klassen im Gymnasio. Quarta war die letzte und Gro-Suprema die oberste . Ich war nach Quarta gekommen. [20] Was hier zu lernen war, Lesen, Schreiben, Rechnen, lernte ich bald genug un d behielt so viel Zeit brig, allerlei Streiche zu ben, die mir viel Verdru brachten . Unter den Lehrern dieser Klasse war ein siebzigjhriger Mann, der sich ganz besond ers an meiner Lebhaftigkeit rgerte und sich bei den vierteljhrigen Zensuren jedesm al bitter und heftig ber meinen moralischen Charakter beschwerte. Ich erhielt dah er immer wortreiche Ermahnungen, ungeachtet ich nicht lssig genannt ward. Nach ei nem Jahre sollte ich in eine hhere Klasse versetzt werden, und hier ereignete sic h folgender unangenehmer Vorfall: Es war den Schlern des Gymnasii verboten, Stcke zu tragen; dessenungeachtet trug i ch wie mehrere Schler ein Rohr, das ein Geschenk eines angenehmen Mdchens war. Ein er meiner Mitschler, mit dem ich viel umging, verlangte, da ich ihm dieses Rohr ge gen etwas anderes vertauschen sollte, welches ich ihm rund abschlug. Eines Tages ri er mir unvermutet das Rohr aus der Hand und rannte davon. Ich geriet in Wut, holte ihn ein, doch ehe ich ihn erreichte, warf er das Rohr in den nahen Flu, er selbst aber entkam. Ich sprang ins Wasser, die Stelle war nicht tief; doch ehe i ch mein Rohr erreichte, hatte es der Strom ergriffen und ich mute es zu meinem hch sten Verdrusse davonschwimmen sehn.
Andern Tages vor Ankunft des Lehrers in der Klasse ergriff ich den Ruber und schl ug ihn, da er frchterlich schrie. Der alte Lehrer trat in die Klasse, und sogleich erzhlte ihm der gestrafte Verrter, da ich gegen das Verbot einen Stock getragen, d en er mir entrissen und ins Wasser geworfen habe. Darber sei er von mir so zugeri chtet, da er zu Hause gehen und sich ins Bette legen msse. [21] Der alte Lehrer redete jenem freundlich zu, er solle nur da bleiben und vol le Genugtuung an seinem Mrder (so nannte er mich) erhalten. Unterdessen hatte ich mich ausgeruht. Ich trat vor den alten Mann und erzhlte ihm und der ganzen Klasse den Vorgang der Sache nach meiner Art. Schweig, Mrder! war d ie Antwort, und abermal und immer: Schweig! Ich lie mich dadurch nicht stren und fuh r in meiner Erzhlung fort, bis ich nichts mehr zu sagen hatte. Der alte Mann stampfte mit den Fen und war auer aller Fassung; meine Mitschler aber sagten mir nachher, sein groer rger habe ihnen schmerzlichen Jammer erregt, denn e r habe dabei geweint. Ich konnte mir nun nicht mehr helfen; die Sache war geschehen, und was erfolgen sollte, mute ich erwarten. Da ich ihm unleidlich war, wute ich, und wie ich ihm zug etan war, konnte er auch wissen, denn seine Lehrart schien mir langweilig und er regte oft genug meinen jugendlichen Kritizismus: so erklrte er wiederholentlich a uf die nmliche Art das Wort Bucephalus und sagte : Bucephalus war Knigs Alexandri M agni von Mazedonien Reitepferd; wenn aber Alexander Magnus ausreiten wollte, so sprach er: Sattelt mir meinen Bucephalum! Mein Trost war, da ich mich unschuldig wute und nach wenigen Tagen in eine hhere Kl asse versetzt zu werden hoffte, wo ich dem alten Manne auer den Augen war. Der erwnschte Zensurtag erschien. Ich war Primus der Klasse, doch ich ward nicht zuerst verlesen. Meine Mitschler wurden mit Prmien, Lob, Aufmunterungen [22] und E rmahnungen entlassen. Ganz zuletzt erscholl mein Name, und es erging ber mich das Urteil: ich sei ein ausgelassener, frecher Bursche und unwrdig, ferner unter mei nen bessern Mitschlern zu sitzen, ein Verderber, ein gewaltsamer Bube. Ich werde daher von dieser Schule ausgestoen und hiermit entlassen: Est petulans, petulantior, petulantissimus! Noch tnen mir, indem ich schreibe, diese Worte des alten Rectoris vor den Ohren, die mich auf einmal ganz niederschlugen, indem ich mich jetzt wirklich schuldig glaubte, in Gegenwart und im Namen aller Lehrer und Mitgenossen der Schule so be zeichnet zu werden. So ging nun fr diesmal alles auseinander. Die Schler gingen vergngt ihren Weg auf d ie Spielpltze, den Osterferien entgegen. Von mir sonderte sich alles ab, was mir hold gewesen war, und ich allein ging ohne zu wissen wohin in verworrnen Gedanke n. Ich kam an die Friedrichsbrcke. Hier war ein Wehr, wo das Wasser sich durch ei ne ffnung prete, jenseits mit Brausen in die Hhe spritzte und sich in den Strom ver lor. Hier stand ich eine Weile und sah in die rauschende Flut. Es erwachte in mi r eine angenehme Vorstellung von der Seligkeit dieses Gewssers, das so froh und f rei seinen Weg dahinflo. Zu Hause hoffte ich keinen willkommnen Empfang, und ich bekam Luft, mit diesem S trome fortzugehn. Es wird mir schier unmglich, das Vergngen in Worte zu bringen, d as ich in der Vorstellung fand, mich hier allen Vorwrfen, Verhren, Beschuldigungen , der Verachtung meiner Mitschler, dem Unwillen meiner Eltern durch einen kleinen Sprung in diesen blauen Himmel [23] zu entledigen. Ich stand so nahe, da ich nur den Fu heben, nur schreiten durfte, und ich war frei. Ich ward von einer sanften Hand ergriffen. Es war die nmliche Hand, welche mein R
ohr ins Wasser geworfen hatte. Der Jngling war voller Schmerz ber meinen Unfall, d en er veranlat habe. Ich zog meine Hand zurck und ging meinen Weg, ohne mit ihm zu reden. Mein Vater zeigte sich sehr ernsthaft gegen mich, und meine Mutter schwamm in Trn en. Wer aus der Sache nicht klug werden konnte, war unser Organist, der auch eine Sc hule hielt, denn man hatte nicht die Vorsicht gehabt, meine Eltern von meiner Ve rweisung und deren Ursachen sogleich zu benachrichtigen. Dieser frchtete ein grob es Verbrechen von meiner Seite und vernahm mich darber mit Gte. Als ich diesem all es, was ich wute, aufrichtig erzhlt hatte, nahm er mich unterdessen in seine Schul e auf. Hier war ich nun wieder froh und wohlgemut. Meine Mitschler waren bald meine Leut e, die ich in allerlei eigenen Kunststcken unterwies. Unter diesen befand sich ei ns, mit einem Fue ber die Lehne eines ziemlich hohen Stuhles wegzuschlagen. Dies S tckchen ward allgemein als eine gelinde Bewegung versucht und erregte bei den Ung eschickten vielen Spa. Eines Tages standen alle Schler um den Organisten herum, um unsere Ausarbeitungen einzureichen, welche durchgesehn werden sollten. Der Orga nist, welcher anfangs mit dem Rcken gegen das Fenster stand, kehrte sich um und ff nete das Fenster, um einen Auflauf zu sehn, der auf der Strae vorging. In dem Aug enblicke versuchte ich mein Kunststck mit dem Fue an einem ziemlich erwachsenen Bu rschen[24] namens Bartollius; dieser aber bewegte sich, und ich traf ihn mit dem Hacken so krftig auf den Scheitel, da er wie tot zur Erde fiel. Ich ri ihn von der Erde auf, fuhr mit ihm zur Tr hinaus und sogleich unter den Brunnen, wo ich ihm das Blut abwusch und nicht eher ablie, ihm den Kopf und die Schlfe zu reiben, bis er sich vllig erholte. Dieser htte mich nun abermals einen Mrder schelten knnen. Als wir wieder in die Schulstube traten, fragte der Organist den Bartollius, wovon er so na wre und so totenbleich ausshe? Ihm sei nicht wohl geworden, sagte dieser, er sei mit mir zum Brunnen gegangen und das khle Wasser habe ihm wohlgetan. Kein Schler hatte etwas verraten, da der Organist uns nicht sogleich vermit hatte; aber diese Geschichte rhrte und erschtterte mich innigst, und ich fate eine Liebe zum B artollius und zur ganzen Schule, da ich mein Leben dafr hingegeben htte. Unterdessen hatte sich der Organist nach der besondern Ursache meiner Verweisung beim Rektorate des Gymnasii eifrig erkundigt und konnte keine hinlngliche Ursach e einer solchen Strafe finden. Er mittelte sogar aus, da die Lehrer ber meinen Cha rakter verschiedene Meinungen hegten. Einer hielt mich fr petulant und aufrh re risch, ein anderer fr still, ja fast leblos, ein dritter fr tckisch und rachgierig, und e in vierter wollte sogar etwas Zrtliches, Romantisches an mir wahrgenommen haben. Es kann auch sein, da jeder von ihnen fr sich recht hatte, indem ich mich jedem ze igte, wie er mir selber gefiel. Kurz, ich ward wieder aufgenommen, mute jedoch zu r Genugtuung des alten Lehrers in Quarta bleiben, wo ich nichts mehr lernen konn te als neue Hndel, an welchen denn auch kein Mangel war, [25] weil ich jeden zur Verantwortung zog, der mir meine Verweisung vorrckte. Das Schmerzhafteste war mir jetzt mein Abschied von der Schule des Organisten, u nd Bartollius war untrstlich, weshalb ich denn whrend der Ferien des Gymnasii frei willig in diese Schule ging, um nur bei meinen alten Freunden zu sein. Es war das Jahr 1773. Um diese Zeit wurde meine ltere Schwester an den Kaufmann S yring verheiratet, der viele Jahre im Dienste eines ansehnlichen Handlungshauses gewesen war. Der Prinzipal dieser Handlung hatte einen einzigen Sohn, der mit m ir das nmliche Gymnasium besuchte; da dieser aber schon in den hhern Klassen war, so lernte ich ihn jetzt erst kennen. Saltzmann, so hie dieser Jngling, war von ern sthafter Natur, und bei dem sichtbaren Fleie, mit welchem er sich den Studien wid mete, nicht eben der Gesndeste. Ihm schien jedoch meine Lebhaftigkeit zu gefallen , wie sein angenehmes Wesen mich zu ihm hinzog, denn in seinem Umgange war ich g ern ruhig, und indem ich meine Schularbeiten mit zu ihm hinnahm, arbeitete ich s
olche daselbst aus und geno seiner lehrreichen Anweisungen. Dafr wnschte nun Saltzmann gleichfalls an meiner freien Beweglichkeit Anteil zu ne hmen, es wollte aber nichts gelingen, da es ihm an Kraft und Atem gebrach. Er ha tte einen Fechtmeister, und da ich dem Unterrichte desselben tglich beiwohnte, so kam ich bald weiter als Saltzmann, denn ihm fehlte die Dauer, und ich fhrte zule tzt meinen Rapier so krftig, da selbst unser Meister seine Arbeit mit mir hatte. Von Saltzmann wurde ich nur zu bald getrennt, weil [26] er die Universitt bezog, und ich erwhne seines angenehmen Umganges blo deswegen, weil dieser Jngling einen g uten Einflu mancher Jahre auf mich zurcke gelassen hat, dessen Gefhl mir gleich geg enwrtig war. Sein ernsthaftes, gesittetes Wesen, besonders aber das Fechten mit i hm und seinem Lehrmeister schien mir gleich edler und blieb mir lieber als die g emeinen jugendlichen Spiele meiner brigen Genossen. Unterdessen war ich zur dritten und endlich zur zweiten Klasse befrdert. Was hier zu lernen war, fand ich bald so kindisch und leicht getan, da ich Zeit genug zu Torheiten aller Art brig behielt. In jeder Klasse fand ich daher wenigstens einen Lehrer, der mir nicht wohl wollte. Einem der Professoren der zweiten Klasse konnte ich auch bei vlligem guten Willen von meiner Seite nichts recht machen. Dieser Mann war eine so eigene Art von Ka rrikatur, da man sich in der Tat hten mute, ihn nicht zum besten zu haben. Seine Be wegungen und Reden, sein Ton und Takt sollten, wie ich wohl merkte, bedeutend se in und Ehrfurcht einflen, doch geriet niemals, was er gern wollte; immer kam etwas ganz Verschiedenes an den Tag. Eine seiner Gewohnheiten war, nach einer vom Kat heder getanen Frage herabzusteigen und die Antwort unten zu erwarten; gingen nun die Antworten gut, so sprang er an manchen Tagen wie ein Vogel im Kfig bald auf, bald ab und gewhrte dadurch mutwilligen Schlern einen erwnschten Anblick. Er war e ndlich auffahrend und entzndbar ber Kindereien, die er fast immer auf das belste au slegte; dann wurde er rot am Halse, er mute wiederholt niesen, und zuletzt war er so aufgebracht, da er alle Fassung verlor. [27] Er lie, wenn ich nicht irre, den Julius Csar lesen und verlangte einst, da darb er lateinisch disputiert werden sollte. Ich merkte bald, da es heute zu einem Jub el kommen msse; der Professor war schon verdrielich worden, fing an, sich zu rgern und mute niesen. Ich rief: Prosit! und sollte deswegen Ultimus gehen. Ich entschuld igte mich damit, da ich ja lateinisch gesprochen htte; darber fuhr er vom Katheder herab auf mich los und schlug nach mir; ich bog mich sanft zurck und der Schlag f uhr meinem Nebenschler so derb ins Gesicht, da ihm das Blut aus der Nase drang. Eines Morgens hatte ich mich versptet und die Lehrstunde war bereits angegangen. Indem ich in die Klasse trat, fragte soeben der Professor einen andern Schler: Qui d est Bucephalus? Im Augenblicke stand ich vor dem Katheder, und mit dem nachgeah mten Pathos des alten Pedanten in Quarta hub ich an: Bucephalus war Knigs Alexandr i Magni von Mazedonien Reitepferd; wenn aber Alexander Magnus ausreiten wollte, so sprach er: Sattelt mir meinen Bucephalum! Und Zelter geht Ultimus! erscholl vom Katheder mein Lohn fr diese prompte Antwort, welche allerdings von mir nicht war erwartet worden, aber die ganze Klasse gerie t dadurch in lebendige Bewegung, weil alle diese Redensart kannten. Dieses Ultimusgehen machte mir zuletzt eher Spa als Verdru, weil ich wieder in die Hhe rckte, sobald nur zertiert wurde. Das Schlimmste dabei war jedoch, da alle die se Historien mein schlechtes Herz und hmische Neigungen verraten sollten, wodurch ich mich denn sehr gekrnkt fhlte. Der nmliche Lehrer legte einst allen Schlern, welche [28] ihre Arbeit nicht vollen det hatten, die Bue auf, den hundertundneunzehnten Psalm abzuschreiben. Ich war n icht unter den Benden; da ich aber nichts anders zu tun wute und nicht ohne Vergngen
meiner Mutter aus den Psalmen vorlas, schrieb ich den Psalm auch, der mir wenig Mhe machte, und reichte ihn stillschweigend mit ein. Dies wurde mir nicht wenig b el genommen, und ich mute den bittern Vorwurf darber anhren, da ich mir keine Mhe ver drieen liee, meinen bsen Willen zu beschftigen. Andere Lehrer beurteilten mich indessen viel schonender. Unter diesen war ein al ter Mann namens Nouvel von etlichen und siebenzig Jahren, der die historischen S tunden in der dritten Klasse hielt. Dieser lie das Vorgetragene von den Schlern au fschreiben, welches ich schnell und gern tat. Da er ein Enkel eines im siebenzeh nten Jahrhunderte aus Frankreich vertriebenen Reformierten war, so erzhlte er ein st die Leidensgeschichte dieser seiner geliebten Vorfahren mit vieler Herzlichke it, wodurch ich innigst gerhrt wurde. Ich verfertigte meine Relation ber das Gehrte und las sie selber vor. Davon wurde der alte Mann so ergriffen, da er seine Hand auf meine Schulter legte und mir sagte, er werde mich bei jeder Gelegenheit ver treten, wo man mein Herz und meinen Charakter verdammen wolle; ich sei ein guter Junge, und es knne aus mir wohl etwas werden, wenn ich mich zu den Alten hielte. Im Anfange des Jahres 1774 kndigte mir mein Vater an, da es jetzt von mir abhange, das Gymnasium zu verlassen, weil ich auf Ostern die Profession anfangen solle. Unterdessen solle ich in der Kunstakademie das Handzeichnen desto ernsthafter tr eiben und in der Geometrie [29] wohl bewandert werden. Dies alles tat ich gern u nd machte im Zeichnen Fortschritte. Ich war ein Freund des nachherigen Kupferste chers Georg Hackert, mit dem ich im Zeichnen ziemlich Schritt hielt, solange er in Berlin war; doch fing nun auch das Gymnasium an, mir interessant zu werden. I ch sa in Sekunda, wo mir das Lateinische und Griechische Vergngen machten, und da es in meinem Belieben stand, blieb ich noch im Gymnasio, bis mich ein unangenehm er Zufall abri. Ein Primaner, ich glaube, er hie Budak, begegnete mir nach geendigter Lehrstunde in einem der engen, dunkeln Gnge des Gymnasii, welcher nach Quarta fhrte. Da wir b eide schnell gingen, war es kaum vermeidlich, nicht aneinander zu stoen. Er schim pfte mich einen Sekundanerknoten, der einem Primaner Platz machen msse! Warte! schr ie ich, indem ich ihn packte, ich will Dich knoten, Du sollst mir lebenslang den Sekundanern aus dem Wege gehn! So schleppte ich ihn nach Quarta, wo der Saal offe n war, legte ihn ber eine Bank und einen Tisch und drosch mutig auf ihn los. Er s chrie ganz entsetzlich; eine Menge Menschen und endlich der Polizeidiener liefen herbei. Dieser fhrte uns beide auf die Polizeistube, woselbst wir zu Protokoll g enommen wurden. Budak war Alumnus und wohnte im Hause. Der Polizeiinspektor, dem er von seinen Eltern besonders empfohlen war, hatte ein Protokoll gemacht, das mir eben nicht erfreulich schien, worin wieder so etwas von Meuchelei, Faustrech t und gewaltsamer Antastung vorkam. Ich ging zu Hause und sagte meinem Vater, da ich gestern vom Gymnasio Abschied genommen htte und willens wre, nicht wieder hinz ugehn. So kam ich von dieser Schule ohne Prmium und[30] ohne Abschied und fing nun an, m ehr Musik zu treiben, das indessen gar nicht recht vonstatten gehn wollte, weil ich sehr weit zurcke war und auch wohl nicht grndlich genug war unterrichtet worde n. Mein Organist lie mich nun die Orgel spielen. Sonnabends probierte ich die Cho rle in der Kirche, welche Sonntags gespielt wurden, und deswegen a ich an diesen T agen beim Organisten zu Mittage, bei dem ich meiner Eltern wegen wie ein Kind de s Hauses angesehn war. Ich hatte berhaupt eine stille Neigung zu diesem ernsthaft en Manne. Er war Kantor und Organist an der Dorotheenstdtschen Kirche wie auch Le hrer an der Schule dieser Kirche und hie Rokmmer. Seine Haushaltung bestand in sein er schnen muntern Frau, zwei angenehmen Tchtern, einer bejahrten, ernsthaften Schw ester und einem artigen Hndchen, das sich immer freute, so oft ich kam. Obwohl es in diesem Hause sehr sittsam zuging, so war ich dennoch gern da und suchte mich auf meine Art besonders den Frauen gefllig zu machen, die mich denn auch mit all erlei weiblichen Auftrgen versahn. Als ich einst kam, war das Hndchen krank und di e jngste Tochter weinte, da es sterben solle; es hatte einen Knochen quer im Maule
sitzen, der sich nicht herausziehen lie, weil der Hund entsetzlich schrie, wenn er angegriffen wurde. Wie ich in die Stube trat, kroch das kranke Tier hervor un d klagte jmmerlich; ich nahm es auf und ri ihm den Knochen aus dem Maule, worber da s Haus in Freuden und das Tier in kurzer Zeit hergestellt war. Das Hndchen war mir so hold geworden, da es gern mit mir ging, welches auch der Or ganist gern sahe. Einstmals war es uns in die Kirche gefolgt und fiel von der gl atten Orgelbank auf den Boden und gab kein Zeichen [31] des Lebens von sich. Der Organist gab einem Kurrendeknaben den Auftrag, das tote Tier in die Spree zu we rfen. Ich sollte fortspielen, konnte aber nicht, weil mir der Hund in Gedanken l ag und mich sein jammerte. Ich lief dem Kurrendeknaben nach und erreichte ihn di cht am Wasser. Es war kalt, ich nahm dem Buben das Hndchen ab, wickelte es in mei n Schnupftuch, steckte es in den Busen und ging damit in voller Hast wohl eine S tunde lang Strae auf, Strae ab. Das Tier lebte wirklich wieder auf und so trug ich s zum Organisten, legte es unter den Ofen, bedeckte es, wusch es mit Wein, und d er Hund lebte, a und freute sich wieder. Da der Organist mehrere Schler hatte, so war auf einem Sonnabend ein Zertamen in der Kirche angesetzt, wo einer von uns den Sieg davontrug, der mich wegen meines angenehmen Verhltnisses im Hause des Organisten beneidete und zum Bartollius ges agt hatte, ich sei des Organisten Hundedoktor. Auch hatte er mein Fuexperiment an dem Bartollius nachher verraten; das konnte ich an den Frauen im Hause merken. Dieser Mensch war seines Ernstes und Fleies wegen weiter im Spielen als wir ander n, und der Organist berlie ihm oft in seiner Abwesenheit die Orgel, welches besond ers mit mir niemals geschah. Mir aber gefiel dieser Mensch von Natur nicht. Er w ar nicht eben klein, auch einige Jahre lter als ich, aber etwas stark verwachsen, hatte lange Beine wie eine Spinne, mit denen er sich denn auf dem Pedal breit m achte und mich seinebermacht sehn lie. Da er jedoch wenig Fleisch auf den Lenden h atte, so sa er unsicher und machte berhaupt vor der Orgel eine possierliche Figur. Sein Gesicht aber und sein gezierter Gang waren mir vllig unausstehlich. [32] Wenn er stand oder ging, nahmen sich seine beiden Beine, die berall gleich dn n und gleichsam kanneliert waren, wie ein Paar Fackelstcke aus, weshalb ich ihn B ifax nannte. Ich war sehr schlecht auf ihn zu sprechen; schlagen wollte ich ihn nicht, und da er selber es nicht an Gelegenheiten fehlen lie, ihn lcherlich zu mac hen, so hatte er bestndig zu klagen. Einen Sonntag, als wir auch unsere Knste whrend des Gottesdienstes hren lieen, hatte ich einige Hlzchen mitgebracht, welche ich stille unter die Orgelbank legte. Der Organist war unten im Schiffe und wollte von fern zuhren. Den ersten Choral spie lte ich, das Hauptlied ein anderer, und das letzte Lied nebst dem Ausgange spiel te mein Bifax. Bei diesem Ausgange hatte er das volle Werk gezogen, und indem er sich etwas stark bernahm und seine groe Geschicklichkeit auf dem Pedale zeigen wo llte, glitschte er von der Bank, welche berschlug, und lag, wie er gewachsen war, auf dem Pedale, welches ein horrendes Spektakel gab, je mehr er sich bewegte un d sich gar nicht helfen konnte. Ich schrie vor Lachen und rief den Kurrendeknaben zu, es sei eine groe Bestie von der Bank gefallen, die sollten sie gleich in die Spree werfen. Ich nahm die Hlzc hen zwar von der Erde auf, er bemerkte es aber und verklagte mich nun beim Organ isten. Ich ward also frmlich von unserm Organisten zur Verantwortung gezogen. Bifax, der andere Schler, der Kalkant und der Kurrendefhrer muten dem Verhre beiwohnen. Ich be stand fest darauf, da ich die Keilchen zu meiner Bequemlichkeit untergelegt htte, weil mir die Orgelbank zu niedrig sei, auch htte ich solches anzeigen wollen, abe r vergessen. Eine Bestie aber htte ich ihn [33] deswegen genannt, weil er mich ei nen Hundedoktor genannt htte, weswegen ich ihn wrde jmmerlich geprgelt haben, wenn i ch nicht seines elenden Wachstums geschont htte.
Die Sache sollte endlich dahin vermittelt werden, da ich dem Bifax Abbitte tun un d er mir die Hand reichen sollte; dies wollte ich nicht und lief davon. Als ich am nchsten Sonnabend zum Organisten kam, fand ich ihn nicht zu Hause. Auf einer von ihm beschriebenen Tafel las ich, da er mir seinen Unterricht aufkndige, mir sein Haus und seine Orgel zu besuchen verbot, weil er wohl jugendlichen Mut willen verzeihen, doch die Bosheit nicht um sich leiden wolle. Ich wandte mich an die gute Frau; sie verwies meinen Eigensinn mit den liebevoll sten Worten und schlo damit, da sie sich darein nicht mische. Nun wurden die Tchter aufgefordert, sich fr mich zu verwenden; diese sagten, es kme ja nur darauf an, die Abbitte zu tun, was ich jedoch entschlossen ablehnte. End lich ging ich zur Mamsell (zur alten Schwester). Hier kam ich erst schlecht an; diese hielt mir ein solennes Postludium mit vollem Werke: Meine Unart sei unverz eihlich. Man verhtschle mich unverantwortlich in diesem Hause. Sie she dem Wesen s chon lange mit rger zu; durch solche Auffhrung werde ich mir zuletzt die Feindscha ft aller gesitteten Leute erwerben; jeder werde mir sein Haus verbieten; solche Gste verdrben die Jugend des Hauses, mit unendlichen Wiederholungen. Endlich fiel mir selber das letzte ein und wurde versucht: Vor dem nchsten Sonnabend traf der Geburtstag des Organisten ein. Erst sandte ich den Bartollius, der die Sache zwi schen mir und dem Bifax ausglich, ohne da [34] wir uns zu sehen brauchten. Dann m achte ich eine Bittschrift in Versen, worin der kleine Hund seinen edlen Herrn u m Gnade fr den Retter seines Lebens anrief. Dem Hndchen machte ich eine artige spa nische Frse von Papier um den Hals, worin ich die Bittschrift aufstutzte, und am Morgen des Geburtstages lie ich das Tierchen in die Schlafstube, da es denn sogle ich aufs Bett sprang und sich das Papier abnehmen lie. Die Sache gelang, und ich konnte knftigen Sonnabend wieder dort zu Mittage essen, da denn hufig gelacht wurd e, wie ich dem unschuldigen Tiere die besten Bissen reichte und der Hund sie so zu nehmen schien, als ob er sie verdient htte. brigens hatte die Sache zu meinem V orteile gewirkt. Es wurden hundert nrrische Dinge vorgebracht, um nur lachen zu kn nen, weil mich keiner im Hause ansehn konnte, ohne in Lachen auszubrechen. Selbs t das Gesicht der alten Schwester hatte einige Falten verloren, und es schien, a ls wenn man mich jetzt, wo nicht mehr liebte, doch achtete. Ich ging nun ins siebzehnte Jahr. Der Schule war ich entlassen und gegen den Som mer sollte ich bei der Profession arbeiten und mauern lernen. Dies wollte mir ab er durchaus nicht gefallen, und doch wute ich nicht, was ich lernen sollte. Ganz entschiedenen Trieb zu einer bestimmten Sache zeigte ich wenigstens nicht; so st anden die Sachen. Der Sommer war gekommen und nun sollte ich mauern. Hier ergriffen mich die frchte rlichen Blattern. Kaum entrann ich dem Tode, und darber verging der beste Teil de s Sommers. Durch die Krankheit waren meine Augen angegriffen, und ich mute lange nachher noch eine Augenbinde tragen. In dieser langen Nacht [35] und durch das E rwachen neuer Krfte suchte ich mir den Flgel auf und tappte auf den Klaven umher. Die Finger fanden Tne, zu den Tnen fanden sich Gedanken, die Gedanken gestalteten sich zu Bildern. Ich phantasierte nach meiner Art und lernte das Griffbrett ohne Augen jetzt erst kennen. Ich ward vollkommen gesund; der Winter kam, und nun le gte ich mich mit Eifer auf das Klavierspielen. Im Hause war eine schlechte Violi ne, worauf der Organist meiner Schwester ihre Sonaten begleitete. Diese nahm ich und suchte mir die Skala. Dann nahm ich das Choralbuch und spielte Chorle auf de r Violine, weil ich keine anderen bungsstcke hatte. Diese Chorle taten mir fast die Dienste eines guten Meisters. Ich lernte den Ton ziehen und halten, und von nun an waren alle meine Sinne auf Musik gerichtet. Eines Abends wurde mein Vater von einem seiner Freunde, der nachher mein Lehrmei ster in der Profession ward, abgeholt, um in einen ffentlichen (den Brunowschen) Garten zu gehn, wo ein Konzert sollte aufgefhrt werden. Mein Vater nahm mich mit dahin. Es fror im Winter, ich fand keinen Garten, wohl aber eine Menge Brger, Off
iziere und Knigliche Zivilbedienten, die Tabak rauchten, Bier, Kaffee, Wein und d ergleichen tranken, Billard, Karten spielten oder sich durch die nebeneinander l iegenden Sle des Hauses bewegten und lebhafte Konversation unterhielten. In dem e inen Saale war das Konzert. Eine rauschende Sinfonie von Hertel machte den Anfang. Da die Violinen nicht sta rk besetzt waren, so machten die Trompeten, besonders aber die Pauken die Hauptp artie aus. Vor der Sinfonie wurden auch Aufzge geblasen, und den Pauker, der ein geschickter Mann [36] war, umstanden eine Menge Zuschauer, die seine Kunst und F ertigkeit bewunderten. Nach der Sinfonie wurde ein Flgelkonzert, ich glaube von Agrell, gespielt. Da ein ige hundert Menschen gegenwrtig sein mochten, welche sich durch die Musik in ihre n Gesprchen nicht stren lieen, so war von dem Spiele des Flgels nichts zu hren. Nur d ie Ritornelle waren stark genug, neben dem Gewirr der verschiedenen Gesprche gehrt zu werden, woraus ein gar sonderbares Ganze entstand, das mich nicht wenig in V erwirrung setzte. Ich hatte mich hinter den Flgelspieler gestellt, um wenigstens spielen zu sehn. Dieser Flgelspieler war ein junger Kaufmannsdiener Possin von ei nundzwanzig Jahren, sehr geputzt, mit einem Degen an der Seite und einer kstliche n Porzellanpfeife im Munde. Sein Spiel wurde von mir bewundert, berhaupt aber bew ies ich der Musik eine entschiedene Aufmerksamkeit, die mein Vater bemerkt haben mute. Am andern Tage fragte mich mein Vater, ob ich Unterricht auf der Violine nehmen wolle. Dies bejahte ich freudig, und nun lernte ich Violine spielen von einem Re gimentsmusikus namens Mrker, den ich bald bertraf. Mrker verschaffte mir indessen die nhere Bekanntschaft des jungen Klavierspielers Possin, den ich im Brunowschen Konzerte hatte spielen sehn [der nachmals Kapellm eister des Prinzen Heinrich wurde], und nun war meine Freude vollkommen. Ich und Possin waren bald unzertrennliche Freunde; ich besuchte ihn, er mich, und wir t rieben zusammen sehr ernsthaft Musik. Wir schrieben Noten ab, und da ich in der Fingersetzung vernachlssigt war, so unterrichtete er mich darinne, indem er mich einige Konzerte spielen lehrte. [37] Im Januar 1775 starb mein Grooheim, der Kupferstecher Schmidt. Meine Gromutte r mtterlicher Seite und deren Schwester waren die einzigen Erben eines bedeutende n Vermgens und einer hchst merkwrdigen Kunstsammlung von Gemlden, Kupferplatten, Kup ferstichen und Zeichnungen der grten Meister aller Zeiten. Mein Eintritt in das Haus dieses trefflichen Knstlers flte mir eine bermenschliche E hrfurcht gegen Kunst und Knstler ein. Schmidt hatte eine Frau und einen Sohn geha bt, die vor ihm gestorben waren. Nun hatte er dieses ganze Haus nebst einem Bedi enten allein bewohnt. Die Ruhe, der heitere Geist des Hauses, der Anblick der un zhligen Kunstwerke ri mich zur Anbetung hin, und alles Handwerk schien mir auf ein mal eine viehische Qulerei ohne Hoffnung und hhern Gewinn. Indessen die Frauen in den Schrnken kramten und Geld und Gold und Silber suchten, stand ich versunken in den Anblick einer staubigen Niobe, eines Apollo oder Herkules, ob ich gleich di ese Sachen hier nicht zum ersten Male sahe. Was mich aber ber alle Fassung entzckt e, war die Entdeckung eines vollstndigen Apparats der schnsten musikalischen Instr umente, um ein Konzert auszustatten: herrliche italienische Violinen und Bratsch en; ein treffliches altes Violoncell; ein franzsischer Flgel und eine unendliche A nzahl Konzerte, Ouvertren, Sinfonien, Trios, Quadros und Duetten, schn geschrieben und von den besten Meistern. Als Erbe einer Erbin dieses Vermgens eignete ich mir alle die schnen Sachen in Ged anken zu und nahm mir vor, hnliches zu leisten. Tag und Nacht stellte ich mir die se gttlichen Meister vor, sinnend und arbeitend an Werken himmlischer Weisheit in dem Gefhl der [38] Unsterblichkeit und ewigen Jugend des Schnen. Nur die Kunst, s chien es mir, drfe reden, unterrichten, knne erbauen und bilden. So verlor ich mic
h hier wie ein Fremdling in einem unbekannten, schnen Lande. Ein Geheimer Rat und Vetter unserer Familie, er hie Troschel, der sich die Mhe gab , den Mentor der beiden Schwestern auf der neuen Kunstbahn abzugeben, da ihnen f reilich auch alles fremd war, bemerkte meine Verzckung und warnte mich in Gegenwa rt meiner Mutter nach seiner Art vterlich: Die Kunst, sagte er, sei eine Sirene fr junge Leute, die von ernsthaften Wissenschaften ablenke und an den Abgrund fhre. Ich sollte mich damit sehr hten, des Guten zu viel zu tun; ich wrde ihm solches e inst danken. Auch er habe in seiner Jugend an der Poesie gehangen und damit viel e Zeit verschwendet, welches ihm jetzt noch reue; jedoch sei er zur guten Zeit n och seinen Irrtum gewahr worden. Ich wute nicht, wie mir der Mann vorkam, doch ko nnte ich es nicht vergessen; und lange nachher, wenn ich ihn sahe, fiel mir imme r Shakespeares Polonius ein, der sich beklagt, in seiner Jugend so sehr viel von der Liebe ausgestanden zu haben. Ich lernte seine ernsthafte Wissenschaft indes sen hier bald nher kennen: Meine Mutter hatte mir bei den beiden Schwestern ausge wirkt, da ich die beste Violine haben solle; die andere hatte sich der Geheime Ra t fr seinen Sohn ausgebeten. Es wurde ein Mann gerufen, der beide Violinen kannte und sie verteilen sollte; ich entdeckte jedoch nachher, da der Geheime Rat die b este bekommen hatte. Ich sagte dies meiner Mutter und Gromutter, diesen aber schi en der Gegenstand nicht bedeutend genug, um davon viel Verdru zu machen. Ich selb st war froh genug, eine gute [39] italienische Violine zu haben, und so blieb di e Sache wie sie war. Meine Mutter war der Teilung dieser Erbschaft wegen zu ganzen Tagen im Erbenhaus e. Dadurch war ich in unserm Hause fast allein und widmete diese Ruhe und Mue gnzl ich der Musik, wodurch ich denn bald auf meine Fe kam und Violinkonzerte spielte. Ich bekam noch Unterricht von einem guten Violinisten namens Schultz, der Kenntn isse in der Komposition hatte. Ich fing also an zu komponieren, und Schultz ging mir dabei mit Rat an die Hand. Endlich war die Erbschaft geteilt, und meine Mut ter kehrte wieder zu ihrer eigenen Huslichkeit zurck. Sie bemerkte bald, da gar nic hts anders als Musik getrieben wurde. Dies war ihr zwar insoferne lieb, als es m ich im Hause hielt und mich von dem vorigen Lotterleben entfernte, doch konnte s ie es meinem Vater nicht verschweigen, da vom Zeichnen und der Geometrie nicht vi el die Rede war. Es wurden mir Vorstellungen gemacht, die ich billigen mute; ich zeichnete, rechnete eine Zeitlang, doch ehe ich es mir versahe, sa ich wieder tie f in der Musik, wo denn wieder neue Ermahnungen folgten. Es war nun wieder Frhling. Voriges Jahr hatte der Krankheit wegen aus dem Mauern nichts werden knnen, doch jetzt war es ntig, das Versumte nachzuholen. Auf Befehl m eines Vaters fing ich nun mit Macht an zu arbeiten, doch die Luft war bald vorber , weil meine Hnde durch Kalk und Steine und den Angriff des Werkzeugs hart und un frmlich zur Musik wurden. Ich bediente mich daher der gewhnlichen Mittel, besonder s des hufigen Waschens, um solche weich und geschmeidig zu erhalten. [40] Ich hatte nun schon mehrere Gelegenheiten, Konzerte und kleinere musikalisc he Zusammenknfte zu besuchen, und dabei viele neue Bekanntschaften gemacht, die a lle dazu benutzt wurden, neue Stcke kennen zu lernen und womglich meine Bekannten an Virtuositt zu bertreffen. Dann gab es mehrere ffentliche Grten, wo fast in allen Tagen der Woche von den Reg iments- und Stadtmusikern Konzerte bei Bier und Tabak aufgefhrt wurden, die ich n ach und nach alle kennenlernte und fleiig besuchte, auch daselbst Klavier- und Vi olinkonzerte spielte. Um diese Zeit geriet ich in das Haus des Stadtmusikus George, der seine beiden B rder als Gehilfen, einen Sohn und andere Lehrlinge bei sich hatte. Mute ich diesen George zuerst fr einen rohen, gemeinen Mann halten, so lernte ich ihn bald als einen durchaus geschickten Musikus kennen. Er spielte alle gangbare n Instrumente gut, Violoncell und Klarinette vorzglich, als Kontraviolonist war e
r jedoch einzig zu nennen. Die Gewandtheit, Reinigkeit, Kraft und Przision, womit er das Rieseninstrument handhabte, wte ich nicht auszuloben; es war, als ob die m ajesttischen Schritte eines Gottes durch die ganze Musik erklangen. Eine unerschpf liche Freude und Luft an der Musik rechtfertigte seinen entschiedenen Ha gegen Pl umpheit, Verdrossenheit und Pfuscherei der Untergebenen, die es in solchem Falle sehr schlimm bei ihm hatten. Dagegen war er mild und schmeichelnd gegen muntere Jnger, denen gewisse praktische Vorteile geheimnisvoll mitgeteilt wurden. Das Eigenste aber, wo nicht das Wunderlichste, war das Hauswesen des guten Georg e. Er pflegte sich in einer [41] Gegend der Stadt niederzulassen, wo er ohne zu groe Kosten gerumig wohnen und einen Garten dabei haben konnte. In vier bis fnf groe n Stuben waren die Wnde mit den blichen musikalischen Instrumenten bekleidet. Mitt en in der Wohnstube stand ein Familientisch. An den Seiten wenige Sthle, eine Dre chselbank mit Zubehr. Rapiere, Flinten, Reitzeug, Axt, Sge; Nutzhlzer traten unter dem Ofen und Bette hervor; Feuerwerksgerte, auch eine Elektrisiermaschine fehlte nicht, und hundert Dinge, die man selten beisammen sieht. Das Bett, worin er und seine Frau beisammen schliefen, stand auch hier und war n ebenher von vielen, vielleicht acht bis zehn kleinen Hunden bewohnt, die, sowie jemand ins Zimmer trat, nacheinander hervorkamen und zur Luft und Freude des Ehe paars den Willkomm bellten, dann aber ebenso in die warme Feste zurckkehrten. Die Namen der Hunde waren: Syrinx, Pan, Tubal, Midas, Viole, Clarin, Cornette, Gavo tte und andere. In den andern Stuben waren groe hlzerne Bcke aufgestellt, um darunterweg zu gehn un d durch die Tren zu kommen. Die Bcke waren oben mit Dielen belegt, worauf den Wint er ber Blumen und Staudengewchse in Kisten standen. Unten trieben sich Kaninchen, ein Schaf und Hafen herum, die brigen Bewohner ware n Tauben und Vgel der verschiedensten Art, entweder frei oder in Kfigen und Hecken . Auch ein paar Raben wurden tglich im Sprechen unterrichtet. Die Hausfrau lag krnklichkeitshalber fast immer bei den Hunden im Bette. Desto frher morgens stand George auf, lie von den [42] Burschen die Zimmer reinige n, den Tieren Futter geben, die Gewchse begieen und den Garten bestellen. Er selbst sahe nach den Instrumenten, bezog sie, reinigte sie vom Staube, und so ging der Vormittag hin. Nachmittage muten die Leute zusammentreten und Musik machen, Noten abschreiben un d dergleichen. Waren keine Aufwartungen bestellt, so wurde lange musiziert und n ach der Musik, vorzglich im Sommer, im Garten gefochten, gerungen, voltigiert, Ko mdie aus dem Stegreife gespielt und tausend beliebte bungen vorgenommen. Da George sich auch mit dem Feuerwerkswesen beschftigte, wobei jeder seiner Freunde helfen , Papier, Pulver und dergleichen anschaffen mute, so gab es auch dann und wann ei n Feuerwerk, bei dessen Abbrennung geblasen und die Pauken gerhrt wurden. Er nann te dieses sein Augenkonzert und konnte sich lange vorher kindlich auf den Augenb lick freuen, alle diese Dinge anzuznden und in die Luft spielen zu sehn. Es wurde n papierne Drachen von ungemeiner Gre verfertigt, mit Kunstfeuern illuminiert und im Herbste auf dem Stoppelfelde gegen Abend mit langem Feuerschweife in die Luft gezogen. Der Jubel dabei, wenn alles wohl geriet, war erfreulich und viele Tage nachher der Gegenstand der Unterhaltungen. Wer sich dabei ungeschickt anstellte oder verbrannte, wurde vom Meister ernsthaft angelassen. Das ttige Leben dieses Hauses mute mir sehr gefallen, wie emprend mich auch anfnglic h der verschiedene Geruch dieser Dinge anging. Doch ber die Musik, woran ich hier teilnehmen durfte, und das belehrende Ausschelten des scharfen Meisters, welche s (ich mchte sagen:) balsamisch auf mich wirkte, gingen alle anderen Sinne nebenh er. Ich war nur mit den Ohren hier. Nur [43] diese und meine Hnde waren meine See
le und mein Krper, dachten und empfanden. Ich konnte mich hier stundenlang frei a uf allen Instrumenten ben, das ich zu Hause nicht durfte; ich ging mit auf die Trm e der Stadt, auf Hochzeiten, Serenaden, und half die Aufwartungen versehn. Alles dieses mute jedoch meiner Mutter weislich verschwiegen bleiben, denn dazu kam ei n Umstand, der mir bei ihr sehr gefhrlich worden wre. Georges Frau war weder jung und reizend, noch gesund, daher der Gemahl denn ande re Bekanntschaften natrlich fand, die die Hausfrau eiferschtig machten. Durch Beis piel angelockt, hatten auch die jngern beiden Brder sich dergleichen zugelegt, und , wodurch dies Verhltnis ein uerst possierliches Ansehn bekam, so fand sich manchma l dies alles in demselben Hause beisammen, wo es anfnglich lustig und bunt, zulet zt aber allemal strmisch herging. [Die Stimmen der Mnner machten sich dann wie gro bes Geschtz, wozu die Hunde und Weibsbilder das kleine Gewehr pelferten.] Von die sen strmischen Intermezzi profitierten denn der Sohn, welcher Gottlob hie, und and ere aufgeweckte Bursche. Man zerstreute sich mit den Frauenzimmern, und die Jnger lieen sich nun die Brosamen von den Tischen der Herren nach ihrer Art schmecken, wie es gehn wollte. So unanstndig mir nun dies alles vorkam, weil ich genau wute, wie meine Mutter solche Bekanntschaften billigen wrde, so lie es sich doch auch h andwerksgem denken, ja es kam mir (vor) wie eine eigene Komdie, die kein Knig so hab en knne. Kamen nun gar, welches einige Mal geschahe, die Brder hinter das nicht eb en sorgfltig verwahrte Geheimnis der dreisten Zglinge, so war die Hetze vollkommen : es gab Zank und derbe Hiebe; [44] die Hausfrau und mit ihr die Hunde nahmen si ch des Sohnes an, und zuletzt lachten alle Parteien, denn das Eigentmliche bestan d endlich noch darin, da solche Auftritte den gewohnten Frieden des Hauses nur au f einen Tag strten. Am andern Tage ging alles wieder seinen alten Gang. berhaupt w ar's mit Georgen wie mit jedem tchtigen Meister: Man nahm bel, was er sagte, aber es geschah, was er wollte, und das war immer das Rechte. War ich hier nicht zum besten aufgehoben, so mu ich Georgen das Zeugnis geben: er warnte mich. Einst war ich mit ihm allein im Garten. Er sagte: Sie werden ein gu ter Musikus werden, aber mehr mssen Sie auch nicht werden wollen. Ich sagte, da ich auch keinen hhern Wunsch htte. Ja, fuhr er fort, das sind Redensarten, die mir schon bekannt sind. Denn eigentlich wollen die Herren alle alles werden, das ist: Kri egsrte, Baurte, Kommerzienrte, doch zuletzt nebenher groe Musizi oder andere Knstler; aber das geht nicht und gibt am Ende Unglck. Diese Leute, glauben Sie mir, erdrck en, was sie heben wollen. Wenn sie uns auf die Finger sehn, knnen sie es auch; al les raten sie wie rechte Rte; wenn's aber so gemacht wrde, die Hunde wollen's nich t essen! Was gut und fertig ist, haben endlich sie gemacht, kurz, sie sind die H erren, und die Schaffer sind die Knechte. Ich will mit diesen Leuten nichts zu t un haben, und so einer werden Sie am Ende doch auch. Sie sehn wohl, junger Mensch, wie es hier zugeht, das kann Ihnen nicht frommen. Endlich heit es, man hat Sie verfhrt und dann ist der Kuckuck los; ich bin Ihnen h erzlich gut, weil Sie so viel Luft haben zur Musik, aber bleiben Sie von mir. Diese Reden trafen mein Innerstes, vor allem aber[45] rhrte mich die Aufrichtigke it des Mannes in tiefster Seele. Ich wurde dadurch wirklich aufmerksam. Ich hatt e eingesehn, wie sich diese Leute in dem beschrnkten Kreise niedriger Gemeinheit umtrieben und mitten in dem sogenannten lustigen Leben Hunger und Frost litten. Kam der Winter, so fehlte Holz. An Kochen und Essen wurde nur gedacht, wenn der Mittag da war. Man war verdrielich, nichts zu finden. Es wurden nun Leckereien, L iqueurs, Kuchen, Mandeln und Obst erborgt und verzehrt. In dem Hause meiner Eltern dagegen erwartete jede Mahlzeit ihre Gste, und der Unt erschied zwischen Ordnung und dem Zigeunerleben dieses Hauses erschien mir deutl ich. Ohngefhr anderthalb Jahre hatte ich dies Wesen angesehn und mitgetrieben, un d es gab Stunden, worin ich den lebhaftesten Ekel dagegen empfand. Was endlich d er Sache den Ausschlag gab, war, da ich in der Musik hher hinauf wollte, als ich e s hier erreichen konnte. Man trieb die Musik hier nur des Geigens und Pfeifens w egen, wie auch ganz recht war; doch ich verlangte ein Mehreres, und dadurch wurd
e ich gleichsam unwillkrlich von diesem Hause nach und nach entfernt. Da ich jedoch nicht wute, wo ich mit meiner ber alles geliebten Musik hin sollte, so fing ich an, wirklich zu leiden. Es war mir nicht verboten, zu Hause zu spiel en; nur so viel nicht, als ich brauchte und Luft hatte, das hie: unaufhrlich, konn te nicht erlaubt sein; legte ich mich des Abends nieder, so wnschte ich nur, da de r Morgen erst wieder da wre; ich hatte nur fr Musik Gedanken, alles andere flog me inen Sinnen vorber wie die Vgel in der Luft. Mein Vater sprach mir sehr ernsthaft zu: Er habe mich die Musik lernen lassen wo llen, um mir ein bildendes [46] Medium in Stunden der Ruhe zu geben. Immer zu mu sizieren und an alles andere gar nicht zu denken wrde ebenso sonderbar sein, als wenn ich immer ruhen, immer schlafen wolle. Ich werde einsehn, hoffte er, da jede s Gewerbe seine bung in Handgriffen, besonders aber in ununterbrochner Ttigkeit er fordere; die Jahre vergingen, und ehe man sich's versehe, sei man Brger, Vater, d er noch hhere Pflichten htte als die bloe Selbsterhaltung. Dann mte man doch brauchba r sein, welches man nicht sein knne, wenn man es nicht geworden wre. Solche Vorstellungen waren mir allerdings einleuchtend, doch was war zu tun? Htte ich einen Mentor gehabt, einen Freund, der mir diesen Weg nicht blo gewiesen, so ndern auch gefhrt htte, ich wre gern mitgegangen. Doch unter den Handwerksgenossen hatte ich keinen, den ich Freund nennen konnte, weil ich mich nicht zu ihnen hie lt. Meine Freunde bestanden in lauter jungen Musiklustigen, die ich alle zu bertr effen strebte, und so war ich ttig genug, nur nicht auf die Art, wie es mein Vate r wollte, den ich brigens seit meiner Krankheit ganz unendlich liebte, weil ich s eine Besorgnis um mich gesehn hatte. Das Zeichnen auf der Akademie hielt ich fr zweckmig, auch deswegen, weil es mein Va ter gern sahe, und nun verdoppelte ich hier meinen Flei. Mein Freund Hackert, den ich auf der Violine unterrichtete, war meine tgliche Gesellschaft. Er hatte das Kupferstechen angefangen und sollte nach einem Jahre zu seinem Bruder nach Neape l kommen. Ich machte mir eine Aussicht, mit diesem nach Italien zu gehn, um in d iesem Lande der Kunst den Nektar ser Gesnge an der Quelle zu trinken. [47] Ich war voll Hoffnung; meine Fortschritte im Zeichnen wurden bald bemerkt. Der damalige Direktor der Akademie (Le Sueur) schenkte mir Aufmerksamkeit und li eh mir Zeichnungen mit ins Haus. Wenn er in die Akademie kam, setzte er sich neb en mich und unterwies mich, wie ich zeichnete. Er sprach franzsisch mit mir, welc hes mir schmeichelte, und wenn ich meine Zeichnung vollendet hatte, unterhielt e r mich darber und zeichnete mir eigenhndig ein Kpfchen, eine Hand, ein Auge auf den Rand meines Blatts. Durch Hackert, der mit seinen Schwestern bei seiner Mutter wohnte, wurde ich in einem Kreise junger Schngeister bekannt. Ein junger Literatu s war in dem sittsamen Hause einer der Schwestern zugetan. Dieser fhrte mich mit ein. Die jungen Leute, welche teils Theologen und Juristen, teils Knstler werden wollten, beschftigten sich untereinander mit literarischen Produktionen, welche i n dem Kreise verlesen wurden. Dabei wurde stark Tabak geraucht und Bier getrunke n. Gelesen hatte ich auer Gellerts etwas von Zacharis Schriften; Klopstocks Messias und die Bibel hatte ich meiner Mutter fter vorgelesen und aus der letztern vieles behalten. Die Sprache der Bibel aber war mir besonders natrlich und deutsch vorg ekommen, und ich fand zwischen ihr und dem Messias einen Unterschied, als wenn e s zwei verschiedene Sprachen wren, von denen ich die eine wohl nie lernen wrde. Las ich die Prosa der Bibel, so fanden sich zu den Perioden sogleich Melodien in mir an, die ich nicht wieder los werden konnte, und daher behielt ich das Geles ene im Gedchtnis. Las ich Klopstocks Hexameter, so war mir's, als ob die Quelle, woraus jene Melodien sonst unversiegbar flossen, sich auf einmal verschlo; daher war [48] mir's unmglich, nur einen einzigen Vers dieses unsterblichen Gedichtes i m Gedchtnisse zu behalten. In diesen Kreis lie ich mich nun ordentlich aufnehmen; doch ich wute nicht, was ic
h vorlesen sollte. Mein Talent fhlte ich; ich ahnete etwas in mir, doch es lag so tief, so dunkel da, da, wenn ich danach griff, ich immer etwas Unfrmiges haschte. Ich war hier der Einzige, der auf Musik steuerte; selbst was ich sprach, hatte nur musikalische Beziehung und wurde nicht verstanden. Um doch einmal etwas vorz ulesen, nutzte ich gerade diesen Umstand, indem ich mir sagte, du kannst ja wohl schreiben, was du willst; zu verstehn brauchen sie es nicht. ber Musik hatte ich noch Zufllig kam mir Sorgens Autor hat sich im Anfange nischen Dreiklangs (trias eit Gottes zu beweisen. nichts gelesen, weil ich kein musikalisches Buch kannte. Vorgemach dermusikalischen Komposition in die Hnde. Dieser seines Buchs die Mhe gegeben, durch Deduktion des harmo harmonica) den unglubigen Juden und Trken die Dreieinigk
Hier ging auch mir ein Licht auf. Ich verfertigte einen Aufsatz, in welchem ich, wenn ich nicht irre, als Erfinder dieser Idee erschien und zuerst die Dreieinig keit Gottes und seine Allgegenwart berall wo Luft und Odem ist, bewies; ich ging noch weiter in die Zahlen hinein und erklrte nach meiner Art aufs bndigste und wei tluftig genug das ganze Heer der Cherubim, Seraphim und einer unendlichen Anzahl von immer kleiner werdenden Engeln, je grer meine Zahlen wurden. Gegen das Ende wu rde die Sache theologisch, und am Schlusse meiner Vorlesung bemerkte ich erst, d a meine Zuhrer smtlich ihre Pfeifen gestopft und sich in verschiedenen Gruppen abwrt s verfgt hatten, um sich untereinander zu unterhalten. [49] Ich schob diese Unaufmerksamkeit auf die Tiefe der Materie und auf die musi kalische Tendenz, indem ich den Gedanken nicht fahren lassen konnte, da in diesem Schacht ein wichtiger Fund verborgen sein msse. Ein junger Theologe, der sich an die werdende Aufklrung der damaligen Zeit anschl o und seine Zweifel ber die Gottheit Christi mit Tatsachen belegen wollte, tadelte in einem Aufsatze die Wahl der zwlf Jnger Jesu als menschlich und trglich und setz te hinzu: Jesus wrde den Judas nicht zum Jnger gewhlt haben, wenn er ihn von Anfang an gekannt htte. Dieser Einspruch erregte meine polemische Natur. Ich suchte zu beweisen, da es ni cht blo Jesus sei, der diese Jnger gewhlt htte; sie seien ihm vielmehr von Ewigkeit her zugeordert gewesen, um die Weissagung der Propheten zu erfllen; alles Menschl iche an ihnen, und zumal die Verschiedenheit ihrer moralischen Tendenz, sei ein Werk der hchsten Weisheit zu nennen. Zuletzt kam ich insbesondere auf den Judas. Dieser, sagte ich, sei ein Jude gewesen, was man noch heut einen Juden nenne: ei n Mensch, dem ein angeborner Erwerbs- und Handelsgeist beigewohnt, der die Dinge dieser Erde irdisch ergriffen und verfolgt, der gewut habe, da man ohne Geld nich t kaufen, und ohne essen nicht leben und lehren knne. So habe ihn Jesus gekannt u nd eben diesen und keinen andern nach Jerusalem gesandt, das Osterlamm zu bereit en. Geld habe ihm Jesus nicht gegeben, weil er selber keins gehabt, und es ihm a lso berlassen, wo eine solche Mahlzeit herzunehmen sei. Diesen Auftrag habe Judas ohne Einrede gewohntermaen angenommen und auch wie ein rechter konomus vollfhrt, o hne das Lamm zu rauben oder zu borgen. Bei seinem Eintritt [50] in die Stadt htte n ihn die Feinde Jesu gefragt, ob er den Meister kenne. Allerdings! habe er geantw ortet. Was geben wir Dir, wenn Du ihn uns zeigst? Gebt mir Geld, das brauch' ich je tzt, so will ich ihn euch zeigen, da ihr ihn nicht verkennen sollt. Nun habe Judas mit eins Geld gehabt, vielleicht auch etwas bei dem Handel zu erbr igen gedacht, und die Mahlzeit bereitet. Da es zum Sterben kommen solle, konnte i hm bei weitem nicht einfallen. Er wute ja aus der Erfahrung, wie Jesus bei der Fr age vom Zinsgroschen, vom Sabbath, bei der Unterredung mit dem Versucher in der Wste und vielen andern Verfnglichkeiten mitten durch die Gefahr geschritten war. Ko mmt nur an! mute er denken, er wird euch antworten, da euch die Ohren klingen! Jesus kam nach Jerusalem, und was nun geschah, wissen wir. Er starb den Tod der Missetter, aber nicht, weil er verraten war; nicht, weil sein Jnger ihn verraten h
atte : fr die Wahrheit seiner Lehre, die er ebensowenig verleugnen als auf abgesch mackte Fragen antworten wollte, starb er! Vielmehr wute er seinen Tod vorher, dem er recht gut entgehen konnte, wenn er gewollt htte. Was tat aber Judas, wie er diesen Verfolg der Dinge sahe, wie er seinen Herrn ni cht mehr retten konnte, ihn verlassen sehn mute fast von allen andern Jngern, die sich verkrochen, unkenntlich machten, flohen? Ich habe unschuldig Blut verraten!, sagte dieser Weltmensch; und in der Flle der Lebenslust, im Triebe weltlicher Reg samkeit konnte er das Leben nicht mehr ertragen; der Schmerz einer wahren Freund schaft berwltigte ihn, und er selbst gab sich den Tod! [51] Diese Rede erwarb mir die Gunst und nachherige Freundschaft des Professor M oritz, welche bis an seinen Tod gewhrt hat. Der neue Frhling des Jahres 1776 war nun gekommen, und ich sollte leider! nun wie der mauern. In Berlin wurde ein neues Knigliches Kadettenhaus gebaut, daran sollt e ich arbeiten. Mein Vater bergab mich einem andern sehr geschickten Lehrmeister namens Lehmer; hier sollte ich das letzte Lehrjahr bestehn und das Versumte nachh olen. Die erste Bekanntschaft, welche ich hier machte, waren die Hoboisten des Kadette nkorps, welche ganz unwissende Leute waren; jedoch ich nahm mit ihnen, und sie a uch mit mir vorlieb; denn am Ende war ich doch nichts als ein Maurerbursche. Mein Lehrmeister aber selber war nicht unmusikalisch, denn er spielte etwas Viol ine und Violoncell; und wenn Sonntags noch einige Freunde dazu kamen, so gab es in seinem Hause ein kleines Konzert, das ihm ganz wohlgefiel. Auerdem war Lehmer in seiner Art ein gebildeter Mann zu nennen; er war klug, kalt , und wute sich zu halten, um allenfalls fr etwas mehr zu gelten; auch gab es in s einer Zeit noch mehrere Handwerker dieser Art. Es waren bis daher in ganz Deutschland unter den Stnden besonders die Gewerbe deu tlich voneinander geschieden gewesen, indem jedes fr sich eine Kaste bildete, die sich genau zusammenhielt. Daraus waren Gebruche und uerungsarten entstanden, woran sowohl die Stnde selbst, als auch die Glieder derselben genau zu unterscheiden w aren. [52] uere Eingriffe in diese Kasten oder exzentrische Auswallungen von innen muten daher scharf bemerkt werden und Unruhe erregen. In dem Kreise der Gewerbe entstand dadurch eine Art Familienpolizei, die desto a ufmerksamer und ahndungsvoller fr die Mitglieder war, je weniger sie auer diesem K reise bemerkt wurde. Von auen war sie nirgends anzutasten, weil sie nirgends zu e rkennen war, und auch die Gesetzgeber und Staatsmnner beeiferten sich oft genug v ergebens dagegen, indem sie keine Gewerbsleute waren. Die Kaiserlichen und Knigli chen Privilegien deutscher Gewerbe sind zwar alle so prekr gestellt, da sie oft ga nz verschiedene Deutungen zulassen, doch die Gewerke selbst als Eigentmer dieser Privilegien wuten sich solche nach und nach eben deswegen so dem Begriffe jedes H andwerks anzupassen, da durch vieljhrige ruhige Observanz mit Genehmigung der obri gkeitlichen Autoritten nur das darunter verstanden werden konnte, was die Besitze r wollten. So beruhete in dem Gewerbe selbst ein allgemeiner Begriff, den ich den Kreis-Ver stand nennen mchte. Wenn ein Handwerker mehr verstand als sein Handwerk, so war m an sehr geneigt, ihm dies von seiner Gewerbsfhigkeit zu subtrahieren, indem es au f der andern Seite keinem Handwerker schimpflich war, nicht schreiben zu knnen, w eil dem Handwerke selber alles andere nachstehen mute, und daher schreibt sich wa hrscheinlich die groe Virtuositt der Vorfahren in allem, was mit Menschenhnden gema cht werden kann.
Mein Vater vertrauete mir, als er mich in den Gebruchen des Handwerks unterrichte te, da er in dem Hause des Dresdner Advokaten, wo er als Schreiber [53] gedient, schon zum Handwerke verdorben sei und blo durch sein exemplarisch sittliches Betr agen und durch sein Zeichnen und Rechnen sich seinen Meistern, wo er gelernt und als Gesell gearbeitet, unentbehrlich zu machen gewut und deshalb mit den Geselle n immerdar auf einem still gespannten Fu gestanden habe; man habe ihn spottweise den gelehrten Maurer genannt, und wo er als Gesell in Deutschland gewandert sei, habe man ihm berall dies und jenes unter seinen Mitgesellen verschwiegen, was er zwar recht gut erraten, aber niemals aufrichtig von ihnen erfahren habe. Im Handwerke galt eine Handwerkssittlichkeit; wer diese verletzte, ward bestraft , ja oft hart bestraft, und so war es mglich, die Handwerke in Flor zu bringen. E ntstanden nun An- und Eingriffe von auen auf das Handwerk selbst, so war die Bewe gung gewaltig, weil sie ganz war und zusammenhaltend. Die Handwerksehre ging dem Handwerker ber alles, und der geringste Schimpf oder d ie leiseste Verletzung erschuf eine Bewegung. Solcher Bewegungen entstanden whrend meiner Lehrjahre und kurz vorher mehrere. Die Artilleristen, welche vor den Toren der Stadt Kanonen probierten, schossen e inst den Galgen ein. Der Knig wollte den Galgen sogleich wieder aufgebaut wissen, doch dies ging nicht sogleich. Der Stadtmagistrat mute sich in Pleno hinaus verfg en, den ersten Schlag an dem Gebude tun und die Stadtfahne darber schwenken, ehe d ie dabei arbeitenden Maurer, Schmiede, Schlosser und Zimmerleute, welche mit kli ngendem Spiel und fliegenden Fahnen hinterherzogen, Hand anlegen wollten. [54] Friedrich der Groe, seit dem langen Kriege an philosophische Ruhe und bersich t gewhnt, nannte dies ein Possenspiel und verbot es fr die Zukunft. Mein Vater war der Meinung, das Kleine beim Kleinen zu lassen und den Leuten zu gewhren, was in seiner Art unschuldig sei und bleiben knne, wenn die Polizei nur a ufmerksam genug sei; auch stimmten alle erfahrnen Mitglieder der genannten Gewer ke hierin berein und baten den Magistrat, dagegen beim Knige Vorstellungen einzure ichen. Des Knigs Wille war bekannt genug geworden, und nun mischten sich die Phil osophen der Stadt in die Sache; es ward darber gesprochen und geschrieben, und ni emand wollte so verstandlos sein, die Albernheit solcher Aufzge nicht einzusehn, welche nur Unordnungen und Miggang veranlassen knnten. Mein Vater sagte dagegen: Wenn die Leute Aufzge machen, knnen sie freilich nicht a rbeiten; da sie aber tglich arbeiten mssen, um zu leben, und viel arbeiten mssen, w enn sie fr ihre Kosten Aufzge veranstalten wollen, so verbiete sich der Miggang von selber, und gegen Unordnung gebe es unter den Gesellen selber Mittel, die leicht er zu untersttzen wren als abzuschaffen. Indessen blieb immer die Frage stehn: wofr sind solche Aufzge gut?, und diese Frag e lie sich weder gegen obere Behrden noch gegen jene Stadtphilosophen so beantwort en, da an einem rechten Einverstndnisse zu denken gewesen wre. Selbst im Gewerke wa ren darber verschiedene Meinungen. Mein Vater behauptete, es werde dies bald Folg en haben fr das Gewerk und spterhin fr das Land, indem dies eigentlich der Zgel sei, an welchem man mit gehriger Klugheit das Gewerbe [55] fhren und leiten knne; er ha lte es daher auch fr unpolitisch und sei berzeugt, eine politische Regierung msse d ie strksten Arme des Landes (unter Bedingungen, die das Gewerbe genug begrenze) f rei lassen, um so mehr, wenn sie auf der andern Seite hergebrachte Befreiungen a llgemeiner Lasten respektiere. Die Gesellen taten sich bei solchen Aufzgen in Kleidung und Anstand hervor, truge n Degen und beeiferten sich, ihrem Stande Ehre zu machen. Wer gut focht, die Fah ne spielte, tanzte, galant war gegen das Frauenzimmer, ward angesehn; dagegen ei
n Gesell, der Sonntag und Werkeltag arbeitete und sich nicht sauber zu kleiden w ute, weniger geachtet war. Wer schlechtes Handwerkszeug hatte, oder sich wohl gar dies und jenes leihen mute, nachlssig oder unsauber arbeitete, ruchlose Reden fhrt e, sich in fremde Hndel mischte, die Arbeit verunreinigte, ward zur Bue gezogen vo n den Mitgesellen. Man konnte den Ton dieser Leute unter sich gut nennen. Waren die Vergehungen nicht entehrend fr den ganzen Stand, so bestanden die Buen i n Freihaltungen, wobei alles lustig zuging; waren sie es aber, so war die Bue oft grausam und mit Ausstoungen verbunden, von denen keine Errettung war im ganzen D eutschlande. Es dauerte nicht gar lange, so zeigte sich eine Gelegenheit, die Prophezeiung me ines Vaters zu besttigen. Ein Gesell warf dem andern eine tote Katze in seinen Ka lkkasten. Augenblicklich warf dieser sein Handwerkszeug von sich, erregte die bri gen Arbeiter, welche das nmliche taten, und alle Gesellen dieses Baues zogen in G esellschaft umher, riefen die Leute von anderen Bauen ab, und es entstand Bewegu ng in der ganzen Stadt. [56] So unrecht dies war, eine einzelne Sache zu einer allgemeinen Sache der Sta dt zu machen, so gewaltig waren die Anstalten dagegen. berlie man dem Gewerke, die Sache zu vermitteln, so war die Sache in einem Tage ab gemacht, und die Schuldigen konnten nachher zur gebhrenden Strafe gezogen werden. Dagegen ward aber das ganze Militr der Stadt in Bewegung gesetzt, um einige hund ert trunkener Gesellen zu zerstreuen und zum Teil aufzubringen, und es gab einen Lrm, der eine ganze Woche dauerte. Das Kadettenhaus, woran ich mauerte, war nicht weit entfernt von dem Laden einer Bckerwitwe, wo ich einige Male Brot gekauft hatte. Diese hatte zwei Tchter und ei nen Sohn. Der Sohn zeichnete mit mir auf der Malerakademie, weil er sich dem Bau wesen widmen wollte. Ich war schon genug mit ihm bekannt, um bald seine nhere Fre undschaft zu erlangen. Die jngste seiner Schwestern ward von mir im Klavier spiel en unterrichtet, wofr mich die Mutter nach alter Sitte und Sprache: Umsonst kauf' ich den Tod bezahlte, wie ich mich auch sperrte. Das Mdchen hatte ungemein schne un d kluge Hnde, und da ich nicht versumte, sie deswegen zu loben, schritt sie bald f ort und spielte mit vieler Leichtigkeit. Der Bruder Theodor war fleiig und der St olz seiner Mutter, welche jedoch immer ihre Bedenklichkeiten uerte, da so viel Flei nicht auf ein Handwerk verwendet wrde, und dabei zu meinem Lobe sagte, da ich nebe n der Musik ein ntzliches Handwerk triebe. An einem Sonntage kam ich hin und zeig te die Sandrartsche Zeichnung von der Peterskirche zu Rom, welche ich kopiert un d zu dem Ende mitgenommen hatte. Theodor [57] uerte das hchste Erstaunen ber die Gre u nd Schnheit des herrlichen Gebudes, und seit dieser Zeit fand ich ihn oft in tiefe n Gedanken. Das Geld fr den Unterricht hatte sich auf zwlf Thaler angesammlet, wel ches ich eines Tages erhielt. Theodor bat mich, ihm dieses Geld zu leihen, und w ar hoch erfreut, eine solche bedeutende Summe in seinen Hnden zu sehn. Einige Tag e nachher kam des Morgens die Mutter zu mir, und in einer Flut von Trnen beschwor sie mich, ihr zu sagen, wo ihr Sohn sei, welches ich wissen knne und msse. Er sei diese Nacht nicht zu Hause gewesen; er habe dies niemals getan, und es msse ihm ein Unglck widerfahren sein. Ich wute von nichts. Wir waren gewohnt, im Flusse zu baden, doch dies war gestern nicht geschehen, und daher konnte ich keine Antwort geben. Meine Mutter war im hchsten Schrecken ber diesen traurigen Vorfall; sie sa he in Gedanken pltzlich auch ihren einzigen Sohn verloren, und die Predigt und da s Lamento ber mein vieles Absein auer dem Hause, ber das Baden im Flusse wollte gar nicht enden. Doch Theodor war fort, bis endlich aus Straburg ein Brief ankam: Liebste Mutter! Ich habe Dich und meine Schwestern gewi durch meine heimliche Abre ise erschreckt. Ich bin gesund und kenne keine Sorge, als Dich zu betrben. Ich we rde in kurzer Zeit wieder bei Dir sein und Dir dann sagen, was mich von Berlin w
eggetrieben hat. Mitgenommen habe ich nichts, als was ich von meinen Sachen trag en kann, und zwlf Thaler, welche mir Zelter geliehen hat. Ich hielt dies fr hinlngl ich, aber ich werdemich sehr einrichtenmssen. Verzehrt habe ich bisher erst einen Thaler, das brige [58] ist an Trinkgeldern ausgegeben. Lebe wohl und sei nicht z u besorgt um Deinen ewig treuen Theodor. Die Mutter erschien mit diesem Briefe in unserm Hause, da ich denn die bitterste n Vorwrfe hren mute, von diesen zwlf Thalern, welche sie mir wiedergab, kein Wort ge sagt zu haben; ich empfand jedoch die tiefste Krnkung, von seiner Entweichung gar keine Red' und Antwort geben zu knnen, was niemand glauben wollte , ja war im Ern ste bse. Er mochte im Anfange des Mais fortgegangen sein. Im November war er wied er hier. Der Anblick meiner Sandrartschen Zeichnung hatte ihn so ergriffen, da er von dem Augenblicke an den Entschlu gefat hatte, das Gebude selbst zu sehn, als ob es das einzige in Italien wre. Er sammelte sich unverzglich einige hundert italie nische Redensarten, und da er zu einer so khnen Reise in ein fremdes Land keine E rlaubnis von seiner Mutter zu erhalten hoffte, ging er heimlich fort, sobald er die zwlf Thaler in seinem Besitz sahe, mit denen er sich jedoch verrechnet hatte, weil er berall anderes Geld brauchte. In Straburg war er, indem er den Mnster best ieg, mit einem jungen deutschen Edelmann bekannt worden, der ihm einen Pa bis Rom verschaffte und fr eine freie Zeichnung des Mnsterturmes fnf Karolinen und eine Re isekarte gab. Von hier ging er mit seiner Karte in der Hand durch die Schweiz ber Genua und Florenz zu Fue gerade nach Rom. Ich kam, erzhlte er, gegen die Mittagszeit in Rom an, welches mein Wille war, um den ersten Eindruck dieser Stadt der Welt ganz voll zu haben. Ich war erst wenige Straen gegangen, als sich die auf meiner [59] ganzen Reise erhaltene Begierde, die Peterskirche zu sehn, zerteilte und i n dem Anblick der brigen Gegenstnde fast verlor. Ich kam auf den Spanischen Platz, wo man mir eine Wohnung bezeichnet hatte, die ich auch sogleich erhielt, und ko nnte mich den Italienern schon recht gut verstndlich machen. Ich fand einige jung e Deutsche, deren Sprache und Anblick mich aufs allerhchste erfreute. Einer unter ihnen bot sich sogleich an, nach genommener Ruhe mich umher zu fhren, welches ic h jedoch ablehnte. Ich htte, sagte ich, eine ziemliche Reise gemacht, um hier zu sein. Nun ich hier bin, habe ich's in meiner Gewalt, die Peterskirche zu sehn. D eswegen sei ich gekommen, und das solle nicht heute, sondern erst bermorgen gesch ehn, weil ich mir erst Papier und Zeichengertschaften anschaffen wolle, ehe ich d brigens war er ohne alle weitere Notiz von seiner Reise zurckgekommen as Gebude she. , wie er hingegangen war. Denn er hatte nichts als diese Skizze aus Italien mitg ebracht, und da er nun erst die Abwesenheit von seiner Mutter schmerzlich gefhlt hatte, war er zurcke geeilt. Unterdessen hatte ich nun eine gute Zeit lang aufmerksam gemauert, ich mchte sage n: mit Luft, so lange nmlich neue Flle meine Erfahrung bereicherten; auch sahe ich hin und wieder neben mir tchtige Leute tchtig arbeiten und konnte an diesen sogar ein freies genialisches Wesen auch im Handwerke bemerken, wenn dagegen den meis ten die Arbeit blutsauer ward, ihr ganzes Kommen und Gehen, ja ihr Essen und ihr e Freude schleppend und trge erschien. Vllig unausstehlich und gemein aber war mir das Verderben der Hnde und Fe durch das ewige Whlen [60] und Treten unter Schutt und Steinen, Kalk und lauter harten, tzen den Sachen, die mir um so empfindlicher angingen, wenn nasse Witterung oder Klte die Gliedmaen streng und steif mach(t)en. Unter solchen Umstnden waren mir denn Ar beiten, welche dem Krper groe Bewegung gaben, die liebsten: Wenn es etwas zu grabe n, zu laufen, zu schleppen gab, war ich gern dabei, und wohin keiner wollte, da bot ich mich an. Indessen ward ich bald gewahr, da meine Mitarbeiter in solchen Fl len darauf rechneten, mir aufzutragen, was sie nicht gerne tun wollten, und da l ie ich mich denn weniger willig finden und hatte oft die tdlichste Langeweile, wen n ich bedachte, wie viel lieber und besser ich mich bei der Musik als beim Mauer n ausnehmen msse. Ich fhlte hier recht tief und schmerzhaft das Glck derjenigen, we lche mit einem Talente unter begnstigenden Umstnden in die Welt treten. Wre mein Va
ter ein Tonknstler oder ich mit einem Talente zur Architektur begabt gewesen, so htte meinem Glcke bei so trefflichen Eltern nichts gefehlt, da ich hingegen so ein trauriges Leben fhrte. Unter meinen Mitschlern im Gymnasio oder beim Stadtpfeifer war ich munter, aufgelegt zu freien Ausbrchen des Geistes; hier unter diesen Leu ten war ich traurig, ohne Leben, Witz, Heiterkeit. Ost habe ich zu Gott gebetet, da er mir mein musikalisches Talent in ein architektonisches verwandeln mchte, um meinem geliebten Vater frei und frhlich unter die Augen treten zu knnen; zuletzt glaubte ich, es msse so sein, und ergab mich, bis denn wieder einmal die allmchtig e Liebe zur Musik mich packte und alles gewaltsam auseinander ri, was die Resigna tion mhsam erbaut hatte. Es war mein letztes Lehrjahr, und ich hatte den ganzen [61] Sommer hindurch stan dhaft beim Mauern ausgehalten, bis im Herbst ein unangenehmer Vorfall mir das ga nze Wesen aufs neue verhat machte. Das Vordergebude und die Flgel des Kadettenhauses waren bis zum Dache fertig, und im Herbste wurde noch der Grund zum Quergebude gelegt. Ich stand eines Tages in d er Erde etwa sechs Fu tief und mauerte am Fundamente. Es war kalt, ich war verdri elich und hatte Handschuhe angezogen, worber meine Mitarbeiter ihre Glossen machte n. Die Stelle, wo ich arbeitete, ging nahe an der Tr eines Schweinstalles vorbei, der einen beln Geruch gab. Es ward an diesem Tage geschlachtet. Der Schlchter sta nd mit einer Keule an der Tr des Stalles; ein Schwein ward herausgelassen, und in dem es aus der Tre trat, schlug es der Schlchter vor den Kopf, da es gerade vor mic h hin ins Fundament auf meine Mauer strzte. Ich ergriff das Schwein bei einem Hin ter- und einem Vorderfue, wie es gerade lag, und warf es dergestalt in die Hhe und gegen den Schlchter, da dieser zurck auf einen Haufen Steine schlug und groen Schad en nahm. Der Schlchter schrie vor Schmerz, und seine Frau schimpfte unmig in so ent ehrenden Worten, da meine Mitarbeiter unruhig wurden und das Werkzeug wegwarfen. Ich sprang aus dem Graben, schlug das Weib, warf ihr meine Handschuh ins Gesicht und ging zu Hause, wo ich meinem Vater den Fall erzhlte und erklrte, da ich um kei nen Preis wieder dahinginge. [Die Sache war angetan, um Unruhe unter den Geselle n zu erregen, die jedoch beigelegt wurde.] Meine Lehrzeit war endlich um, ich wurde am 10. Februar 1777 losgesprochen. Mein erster Gedanke war, als Gesell in die Fremde[62] zu gehen und mich in der E ntfernung meiner Eltern ganz leise in die Musik zu legen. Doch ich wute nicht gen ug Musik und wollte mich erst weiter bringen. Ich geriet in neue musikalische Zi rkel, ging von einem Konzerte in das andere, und es wurde dabei nichts Rechtes g eleistet, weil ich mich wohl an der freien Gesellschaft ergtzen, aber von diesen Leuten nichts lernen konnte. Darber vernachlssigte ich auch das Zeichnen in der Ak ademie und sahe nun meinen Freund Hackert seltener. Nach einiger Zeit kam Hackert zu mir, um Abschied von mir zu nehmen. Er fand mic h auf dem Hofe beim Kalklschen. Sein Bruder lie ihn nach Neapel kommen, um ihn zum Knstler auszubilden. Dieser Abschied durchdrang wie ein Wetterschlag mein Inners tes. Ich fhlte heute recht lebhaft den Abstand von mir zu einem freien Knstler und seinem Wesen. Ich weinte acht Tage, nicht so sehr um den Verlust des Freundes a ls, ich wute selber nicht recht, warum. Das Land der Gesnge zu kennen war mein heie r Wunsch, doch ich kannte die Sprache nicht; dabei hatte ich eine ungeheure Vors tellung von der Weite und Wrdigkeit des Vaterlandes der Virgile, Horaze und Tasso ; den Himmel dachte ich mir dort hher, Sonne, Mond und Sterne wrmer, heller, und a lles schner. Italienische Komponisten kannte ich nur durch den groen Ruf; auch glaubte ich, It alien sei nicht das Land, wo man lerne, sondern von da aus die Welt unterrichtet werde. Die sieben Hgel und die Peterskirche wrden nur von Heiligen, von Geweihten betreten, an denen sich die Gnade Gottes offenbaren wolle, und fr einen so hoch Begnstigten konnte ich mich nicht halten. Darber versank ich eine Zeit lang in brte nde Melancholie; [63] ich las, schrieb, zeichnete und trieb allerlei Dinge durch
einander, um die Zeit los zu werden. Schon seit einiger Zeit kannte ich einen jungen Stuckarbeiter, der die Orgel spi elte und sehr fertig auf dem Pedale war. Seines stillen und eingebognen Wesens w egen machte ich eben nicht gar viel aus ihm, doch fragte ich ihn jetzt, woher er die bung auf dem Pedale htte. Er antwortete, sein Oheim, der Schullehrer, habe ei n Klavier mit einem Pedale und ein Positiv; darauf be er tglich eine Stunde, und i n der Andacht spiele er die Lieder. Ich bat ihn, er solle mich einmal mit dahin nehmen. Er versprach, seinen Oheim z u fragen, dann wollte er mir Antwort bringen. Eines Tages kam er zu mir und sagt e, wenn ich wollte, so sollte ich ihn und seine Mutter heute abholen, um in die Andacht zu gehen. Ich erschien. Die Mutter konnte gegen vierzig Jahre alt sein. Sie war Witwe und hatte bedeutende Reste ehemaliger Schnheit. Sie fragte mich bal d, ob ich ein Christ sei, ob ich betete, ob meine Mutter fromm sei, zu welcher K irche wir uns hielten, welches ich alles beantwortete, wie ich es wute. Endlich g ingen wir zur Andacht. Wir traten in einen migen Saal von drei Fenstern. An der ei nen Wand desselben stand ein Positiv von acht Registern und vor dem letztern ein Pult, worauf eine Bibel lag. Das brige Gerte des Saales bestand in Sthlen und Bnken , deren mehrere bereits von ltlichen Frauen und Mnnern besetzt waren, die vor sich still im Gesangbuche lasen. Es mochten etwa dreiig Personen beieinander sein, al s der Lehrer erschien und ankndigte, das Lied O Ewigkeit, du Donnerwort werde gesun gen werden. Nach einem Prludium auf dem Positiv begann das[64] Lied, dessen erste Strophe mir Schauder und Entsetzen erregte. Nach dem Gesange trat ein schlichte r Mann an das Pult und sprach ber dieses Lied, indem er der Versammlung den Begri ff des Ewigen auseinandersetzte: Es lasse sich nmlich der Anfang der Dinge in der Welt nicht ohne Ursache und ebensowenig ohne Folge denken. Da nun der barmherzig e Gott den Menschen zu seiner Erhebung und Erhhung mit Vernunft und mit der Neigu ng ausgestattet habe, die Ursachen der Dinge erforschen zu wollen, da dieser Men sch einzusehn vermgend sei, da alles Angefangene natrlich seine Folgen bis in Ewigk eit fortsetze, so sei ein Christ als ein hochbegnadigtes Kind Gottes um so mehr verbunden, immerfort Gutes zu tun und Gutes anzufangen, weil aus dem Guten bis i n alle Ewigkeit Gutes folge, und daher die Seligkeit eines Menschen, der des Gut en viel tue, unermelich und ewig sei. Dahingegen ergebe sich von selber, da gedank enlose, unbedachte Handlungen und Unternehmungen ein bel ber dem andern erzeugten und dem richtenden Gewissen unsterbliche Qual bereiten mten, welche selbst die ewi ge Liebe nicht verhindern knne, ohne die ewige Gerechtigkeit zu verletzen. Dies war der ohngefhre Inhalt der Rede, welche berall mit Stellen aus der Bibel be legt war und kaum eine Stunde whrte, nach deren Endigung das Lied O Ewigkeit, du F reudenwort gesungen wurde. Ich war von dieser Andacht hchlich erbaut worden. Vor allem aber hatte ich whrend des Gesanges eine ungewhnlich klare, volle und weiche Sopranstimme wahrgenommen. Meine Augen suchten umher; man stand auf, man ging. Doch konnte ich keine Gestal t finden, der ich [65] diese Stimme zueignen mochte; es mute eine junge Stimme se in, und ich sahe nur alte, kalte Gesichter. Ich war der letzte der Gste, dankte dem Lehrer und bat um die Erlaubnis, wiederko mmen zu drfen, welche ich auch erhielt. Der Lehrer zeigte mir auf meine Bitte noc h sein Pedal, welches ich versuchte, und so empfahl ich mich. Es war Abend geworden; ein junges Mdchen mute mir die Treppe hinunter den Flur ent lang leuchten. Wie sie das Haus aufschlo, in der rechten Hand den Schlssel und in der linken das Licht hielt, beleuchtete sich ein braunes, entschlossnes Gesicht, aus dem zwei groe schwarze Augen blickten. Eine volle, sorgfltig bedeckte Brust v erlor sich sanft in den kurzen Hals; zwei feste runde Arme und sehr zierliche Sc henkel vollendeten eine stmmige Figur, die sich leicht und gefllig bewegte. Ich wns chte dem Mdchen etwas zu geben; Geld hatte ich zu wenig. Ich zog meine kleine gol dene Tuchnadel hervor, welche oben ein grn emailliertes Kreuz hatte, und gab sie
ihr. Sie nahm sie an, kte das Kreuz mit unendlicher Anmut und steckte die Nadel an ihren Hals, indem sie das Tuch zurckbog und mit behenden Fingern wieder zulegte. Sie dankte mir mit Innigkeit, das Kreuz schien ihr angenehm zu sein; ich drckte einen Ku auf ihre Lippen und sprang zur Tre hinaus. Ich war nur wenige Schritte vo m Hause, als ich mich besann und stillstand. Ich wute selber nicht, was seit zwei Stunden mit mir vorgegangen war; die Eindrcke waren verschieden und doch zusamme nhngend; aber ich war nicht unruhig, und das braune Mdchen behauptete zuletzt das Feld meiner Gedanken. Jetzt erinnerte ich mich, da die wenigen Worte des lieben W esens zwar deutsch, doch [66] so eigen gestellt waren, da sie nicht von hier sein konnte. Aus Sachsen, Westfalen, Schlesien konnte sie auch nicht sein, denn ihre Mundart und Artikulation war bestimmter, energischer, als man es insgemein unte r den Deutschen findet. Dies beschftigte mich ganz angenehm, ohne zu einer Meinun g zu kommen. Ich sann darauf, das Mdchen allein zu sprechen, konnte aber auf kein Mittel fallen: Das Haus, wo der Lehrer wohnte, gehrte der Kirche und war immer v erschlossen. Unbemerkt konnte man nicht hineinkommen; so erwartete ich ungeduldi g die nchste Andacht. Der Tag erschien. Die Zuhrerschaft war diesmal zahlreicher, doch der Vortrag, welcher von dem Lehrer selber gehalten wurde, schien mir weder so klar und innig, noch von solchem Eindrucke auf die Versammlung zu sein als d as vorige Mal. Das braune Mdchen aber sah ich nicht, und ich ging traurig von hin nen. Den Tag darauf hatte ich schon keine Ruhe mehr. Ich ging in der Mittagsstun de einige Male an dem Hause vorber, in der Hoffnung, etwas gewahr zu werden. Eben wollte ich wieder von dannen gehen, als sich die Tr ffnete und eine ltliche Frau h eraustrat, die etwas Verdecktes sorgsam trug. Die Frau ging auf die nicht weit e ntlegene Kirche zu; ich folgte ihr von ferne nach, ohne zu wissen, warum. Die Ki rche stand auf einem freien Platze, der mit weier Wsche behngt war. Hier hielt die Frau an und rief: Line!, und siehe, mein braunes Mdchen trat aus der bereinander gehn gten Wsche hervor. Ich fuhr vor Freuden zusammen, ja ich erstaunte ber die maleris che Wirkung, welche die dralle, feste Gestalt auf dem schneeweien Grunde der aufg ehngten Wsche machte. Sie mute den Trockenplatz bewachen, und die Frau brachte ihr das Mittagsessen. Hier stand [67] ich und lauerte. Die Alte ging wieder zu Hause , und Line setzte sich auf einen Waschkorb, um ihr Essen zu verzehren. Ich trat Ich v an sie heran, und sie grte freundlich, indem sie sagte: Wie kommen Sie hieher? ersicherte, da es um ihre[n]twillen geschehen sei, da ich sie gestern in der Anda cht nicht wahrgenommen habe und um sie besorgt gewesen sei. Ja, sagte sie, der Herr Lehrer hat gescholten, da die Madam gestern waschen lie. Er sagte, alles habe sei ne Zeit, und die Wsche htte einen Tag spter geschehen knnen; man msse dem Dienste Got tes keine Zeit entziehn, die ihm ohnehin karg zugemessen wrde. Ich verbarg ihr mei ne Freude nicht, sie hier und allein zu finden; seit neun Tagen htte ich sie beral l vermit und auf Mittel gesonnen, sie zu sprechen. Das Mdchen gefiel mir immer mehr; sie sah in der hohen Mittagssonne aus wie eine frische Orange. Sie bot mir einige Bissen an, die ich nahm, und niemals habe ich etwas dankbarer genossen. Ich mute mich immer mehr verwundern ber die Sprache des Mdchens. Ein wohlgezogner, nicht eben kleiner Mund, leichtes Lippenspiel, eine f reie Zunge gaben allem, was sie sprach, Bedeutung. Man hrte nicht blo deutlich, ma n verstand auch genau. Die Oberflche ihres Gesichts schien fest wie Marmor, wenn sie schwieg; sprach sie aber, so war alles in Bewegung, und ein leiser Schein ju gendlicher Rte schimmerte durch die braune Farbe. Ich fragte, wie sie in dies Hau s komme. Sie antwortete: Ich bin aus Siena im Toskanischen. Mein Vater starb, da ich sechs Jahre alt war, und hinterlie meiner Mutter sechs Tchter. Meiner Mutter B ruder ging alle Jahre von Siena nach Deutschland, wohin er allerlei Waren verhan delte. [68] Er hatte mich sehr lieb, und da ihm meine Stimme gefiel, mute ich ihm immer vorsingen. Einst bat er meine Mutter, da ich mit ihm nach Deutschland reisen mchte . Ich wollte dies nicht gerne und meine Mutter auch nicht; ich wei daher selber n icht, wie es kam, da ich dennoch mitreisete. Auf der Zurckreise starb der Oheim plt zlich am Schlage in einer kleinen deutschen Stadt, wo wir bernachteten, und nun w ar ich verlassen.
Des Lehrers Bruder, der auch auf der Reise und in demselben Hause eingekehrt war , nahm mich von hier mit nach Minden, weil mich die Wirtsleute nicht behalten wo llten. Er hatte auch fnf Kinder, von denen ich deutsch lernte, starb aber auch ba ld pltzlich, und seine Frau sandte mich hieher zu seinem Bruder, wo ich noch bess er gehalten bin als in Minden, nur bin ich noch weiter von meinem Vaterlande ent fernt. Die kurze Erzhlung machte den ganzen Eindruck auf mich. Es schien mir, als wenn d as Mdchen im Sprechen verklrt wrde, und ich bekam eine Ehrfurcht gegen sie wie vor einer Heiligen. Die Bissen, welche sie mir gereicht hatte, schmeckten mir nun wi e Manna; sie selbst aber nahm ich geradezu fr eine heilige Botin. Ich fragte sie, wie sie es denn mit der Religion hielte, ob sie noch katholisch sei, noch ihre Kirche besuche und beichte. Certissimo! rief sie aus in dem Tone der hchsten Wrde. S ie sagte es nicht, aber ihre ganze Artkam mir vor, als ob sie die frhe Entfernung von ihrer heiligen Kirche fr eine bittre Prfung ansah, indem sie mit einer Art vo n Mitleiden von ihrer Herrschaft sprach, der sie dienen msse und mit der sie brige ns keine Unzufriedenheit bezeigte. Trotz ihr(er) Jugend fand ich an ihr pathetis che Momente, in welchen sie aussah wie eine [69] gefangene Knigin, die auf ihre B efreiung hofft und derselben gewi ist. Ich fragte sie, ob sie denn bei den Andach ten des Hauses immer und gern gegenwrtig sei. O ja, sagte sie, denn da darf ich sing en; auer dem erlaubt es die Madam nicht, weil es hier sndlich ist. Ich wollte gern erforschen, was sie von diesen Andachten hielte. Es mag alles gut sein, sagte sie, ich kann die vielen Worte niemals behalten. Die alten Leute sehn aus, als wenn s ie niemals wren jung gewesen, und der enge, niedrige Raum pret mir das Herz zusamm en. Den Messen in den schnen Kirchen zu Siena und zu Florenz habe sie schon als e in schlafendes Kind auf dem Arme der Mutter beigewohnt. Die Gre der Kirchen und di e Gegenwart der Heiligen fehle hier gnzlich. Sie bete nur recht, setzte sie hinzu , wenn sie ganz allein sei, wenn sie sich schlafen lege und aufstehe; und Sonnta gs gehe sie in die Messe. Ich fragte, wie es denn mit der Sprache sei, ob sie ihre Muttersprache hier nich t vergesse? O nein, sagte sie, indem sie mich dreist ansah und ihr ganzes Wesen si ch zu erheben schien, ich bin eigentlich aus Florenz, und meine Eltern sind erst nach meiner Geburt nach Siena gezogen; ich wei auch, da meine Mutter jetzt wieder in Florenz ist, wo ihr Vater noch lebt. Nun, sagte sie, werde ich nach der Wsche sehn mssen. Die Madam wird bald hier sein. h pries mein Glck, sie hier allein gefunden und sie zum ersten Male an ihrer sen St imme erkannt zu haben, und fragte, wann und wo ich sie wieder so sprechen knne. Ic h gehe, antwortete sie, nicht aus als nach der Aufschwemme, wenn ich Fluwasser hole , und Sonntags mu ich zum Pater Giovanni kommen, mit dessen [70] Schwester ich in die Messe gehe. Hier sahn wir die Madam kommen; ich ergriff die Hand des Mdchens und drckte sie. Sie zog sie aus der meinigen, indem sie sich unter die Wsche verlo r, und so entfernte ich mich gleichfalls. Das Mdchen hatte einen tiefen Eindruck auf mich gemacht, und meine ganze Einbildung war mit Italien beschftigt: Flo renz und Siena! klang es vor meinen Ohren im Schlafe und im Wachen. Die nchste Andacht wurde von mir nicht vergessen; ich erschien etwas eher, auch hrte ich die Stimme wieder, doch meine Augen suchten sie vergebens; sie war gleich nach der Andacht davongegangen, und ich mute trostlos fortgehn. Der Gedanke, jetzt acht Tage lang zu schmachten, ohne wieder hieher zu kommen un d sie vielleicht wieder nicht zu sehn, regte meine ganze Beweglichkeit auf. Ich entschlo mich, sie knftigen Sonntag in der Messe aufzusuchen, und wenn ich sie auc h nur sehn sollte. Hier merkte ich bald genug, da dieser Ort dazu weder schicklic h noch gelegen sei. Ein jeder kam und sahe vor sich hin wie auf einen Spiegel, u m sein Innerstes zu beschauen; ich hielt mich fr verstoen, indem ich es nicht wagt e, das geweihte Wasser zu berhren, wie es der Niedrigste tun durfte. Jede tief ve rborgne Neigung trat wie ein Schreckbild vor mich hin; nach und nach war ich den Stufen des Altars nhergekommen; ich stand mitten unter Knienden aufrecht, wich z urck und kam an eine Bank, wo ich mich setzen konnte. Ich wei selbst nicht mehr, w
as ich hier empfand, aber ich wurde ruhiger, wie ich die ganze Messe abwartete, und ging mit den andern aus der Kirche, ohne einen Menschen anzusehn. Ich fhlte m ich erbaut. [71] Es ward Abend. So ging ich in mein Bett, doch nicht um zu schlafen. Vor mei ner Phantasie erhob sich auf lilienweiem Grunde Alinens Bild, erst schwebend, nac h und nach deutlicher in allen Umrissen, zuletzt mit einer Krone und leisem Sche ine um das Haupt. Die junge Brust schlug aus der festen Bedeckung sanft auf und nieder; unter derselben trug sie einen prchtigen Grtel mit roten und grnen Edelstei nen besetzt; ein reiches Gewand bis auf den Boden bedeckte die Fe. Anfnglich waren ihre Augen in die Hhe gerichtet. Sie sang; der Schall schien in di e Hhe zu gehen und mit leisem Nachklange zurck an mein Ohr zu kommen. Sie rief mic h an, ihr Befreier zu werden, sie in ihr Vaterland zurckzubringen, indem sie mir dafr den Segen aller Heiligen zu erflehn versprach. Zuletzt schien sie sich zu mi r zu neigen, und so zerflo das schne Bild, indem es sich zu nhern schien. Ich war bereit genug, dies Traumbild mit meiner Sehnsucht nach Italien zu verein igen. Eine Reise nach Italien in Gemeinschaft dieses Mdchens schien mir nun ein B eruf von oben. Wenige Tage vergingen, und ich hatte einen ganzen Plan fertig, de ssen vornehmstes Verdienst darinne bestand, einen Engel in sein Vaterland zurckzu bringen, und das nchste, meinem eignen Vaterlande einen ausgebildeten Knstler zuzu fhren. Mein Grooheim Schmidt war auch in seiner Jugend als Soldat davon- und nach Frankr eich gelaufen und war als ein berhmter Knstler vom Knige mit ansehnlicher Pension z urckberufen worden. Ich sah hierin weder Unmgliches noch Frevelhaftes; meine Neigu ngen stimmten mit den Absichten meiner Eltern wenig berein; dafr konnten sie nicht und ich auch nicht. Ich wurde [72] von niemand verfhrt, mein Gewissen war rein, und die Tugend liebte ich. Mein Entschlu war gefat. Das Mdchen mute ich sprechen, si e von meiner Absicht unterrichten; sie konnte gar nicht nein sagen; sie mute woll en. Ich schrieb meinen Traum auf, erklrte solchen nach meiner Art, bot mich zu ihrem Fhrer, zum Retter an; schwor heilig, da ich sie nicht verlassen wolle, bis ich sie unter den Augen ihrer Mutter wisse. Ihre Sprache und die meinige sollten uns si cher an Ort und Stelle bringen, und sei ich nur erst einmal in Italien und beson ders in dem schnen Florenz, dann solle Gott und meine Musik und ihre himmlische S timme das Angefangene vollenden. Mein Aufsatz war fertig. Nun aber mute sie ihn auch haben und lesen knnen; ich hat te ihn mit lateinischen Lettern geschrieben und hin und wieder italienische Wort e gebraucht, wie ich sie aus den Opern des Metastasio kannte. In der nchsten Anda cht sahe ich sie, doch es war unmglich, nur an sie zu kommen; der kleine Saal war voller Menschen. Sonntags frh ging ich ganz frh zur katholischen Kirche. Die Kirc he war offen; es war Frhmesse. Da ich nicht fand, was ich suchte, ging ich langsa m den Weg von der Kirche zu ihrer Wohnung. Ich sah sie aus der Haustr treten; sube rlich und festlich gekleidet und frisch trat sie einher wie eine Himmelsbraut. D a sie mir sagte, da sie heute beichten wolle, war ich schchtern genug, von meinem Plane nichts merken zu lassen, doch bat ich sie um alles, was heilig ist, mir zu sagen, wo ich sie nur einige Minuten allein sehen knne, weil ich ihr etwas beraus Wichtiges zu erffnen habe, das das Glck ihres Lebens betreffe. Sie besann sich ei nen Augenblick, und dann sagte sie, ihre Frau habe ihr [73] befohlen, Gartengewch se zu bestellen. Sie wisse noch nicht, wenn ehe sie werde dort hingeschickt werd en, doch werde es wohl morgen nach Tische geschehen. Da sie nicht langsam gehn w ollte, so waren wir bald genug in der Nhe des Pater Giovanni, und ich mute abziehn . Ich kam mir hier wieder vor wie verstoen von allem, was mir lieb war, und die U nbefangenheit des Mdchens war erdrckend fr mich. Den folgenden Mittag ging ich wieder auf meinen Posten. Nach einer Stunde erschi
en sie zu meiner groen Freude. Der Grtner wohnte auer dem Tore; das war ein herrlic her Zufall. Nun erzhlte ich erst alles, was ich zu sagen hatte. Anfnglich schien s ie kalt, zu letzt konnte ich ihren entschiedenen Wohlgefallen bemerken. Sie nahm meine Schrift und versprach sie zu lesen und zu berdenken. Von Einwendungen, wel che ich befrchtet hatte in Absicht auf ihre Sicherheit, mit mir zu reisen, und ih ren unbefleckten Ruf lie sie nichts merken. Sie sprach vielmehr davon, wie ich vo n hier entkommen, mich von meinen guten Eltern losmachen knne? Ohne Reisepa, ohne Geld, zu Fu und dergleichen. Alles das war in meinem Plane glcklich vergessen, und ich war in der Tat verlegen, ihr zu antworten, [denn ich hatte hieran wirklich noch nicht gedacht]. Anfnglich wollte ich Theodor zum Vertrauten machen, doch er hing sehr an seiner M utter, und seit mancher Zeit hatte ich ihn weniger gesehn; und, um aufrichtig zu sein, ich tadelte seine Reise, sein Laufen nach Italien um nichts und sein gesc hwindes Wiederkommen, ja ich beneidete sein Glck. Er konnte wenig sagen, weil er wenig gesehn hatte; htte er mich mitgenommen, die Reise mute fruchtbarer fr ihn gew esen sein; deshalb nun [74] wollte ich fort, gleichfalls ohne ihm davon zu sagen , nur hatte ich keinen, der mir Geld lieh; das war mein grter Verdru. Auch hier fan d sich Rat. Ein alter Freund meines Vaters hatte mir zu meinem Gesellenstande ei n franzsisches Reizeug geschenkt, worin ein nicht kleiner Winkelmesser mit bewegli chen Dioptern in Form eines Proportionalzirkels und ziemlich starker Nu, wie auch alles brige von seinem Silber und ungemein sauber gearbeitet war; dann besa ich e inen silbernen Becher, den mir meine Mutter geschenkt hatte, silberne Schnallen, ein silbernes Tafelbesteck, einige Medaillen, worunter eine goldene war. Andere Sachen, als zum Exempel mein Handwerkszeug, eine Mekette, einige Partituren, ein e Windbchse, ein Paar Pistolen, zwei Rapiere, ein spanisches Rohr, wollte ich hie r verkaufen und daraus konnte berhaupt gegen hundert Thaler gelst werden. Meine it alienische Violine nahm ich mit. Von Dresden an sollte die Wanderschaft zu Fue vo r sich gehn. Hier sollte die Kleidung verndert werden, welche ich mir etwas roman tisch ausgedacht hatte. Schnrstiefeln, lange Beinkleider, ein Jckchen, ein nicht z u langer Mantel, eine Schrpe und ein runter Hut standen im Anschlage; so wollte i ch mit meiner Huldin von Ort zu Ort wandern und unterwegs unser sparsames Leben mit Singen und Spielen fristen. Dabei wollten wir uns nett und reinlich halten, um berall anstndig erscheinen zu knnen. Von Dresden aus wollte ich an meinen Vater schreiben und um Geld bitten, welches er mir gewi nicht vorenthalten wrde; und den Schmerz, den meine Entweichung verursacht haben konnte, wollte ich durch ein re chtschaffnes Leben und unermdliche Ausbildung meines Talents reichlich vergten. Di es alles wurde teils anschlagsmig, [75] teils historisch und prophetisch zu Papier gebracht, um Alinen zu bestechen, mit der ich noch grere Absichten hatte. Sie sollte meine Primadonna werden; aus ihr wollte ich eine Sngerin bilden, deren Ruf bald wieder von Italien nach Deutschland ertnen sollte. Von Hassen wute ich, da seine Frau, die berhmte Faustina, seinen groen Ruf gegrndet hatte. Aber Hasse hat te sich katholisch gemacht; darinne lag etwas gegen meine Natur. So sehr ich auc h diesen Glauben jetzt ehrte, so berzeugt hielt ich mich, da jeder Glaube allein s eligmachend sein msse; daher denn ein Mensch, der seinen Glauben verndere, keinen haben und also keinen finden knne. Ich war stolz darauf, von protestantischen Elt ern geboren zu sein. Die vllige Unbeschrnktheit des Herzens, zwischen dem Allerhchs ten, Unerklrbaren und einem behaglichen irdischen Zustande umherzuschweifen und, nur dem eigenen ewigen Gewissen verantwortlich, frei wie ein Planet am Firmament e zu schweben, schien mir das hchste Glck eines Menschen. Dagegen emprte das Sakram ent der Beichte mein Innerstes. Von Kindheit an hatte ich so viel gedacht und em pfunden, was ich keinem sagen zu drfen glaubte; mein jetziger Zustand selbst war von dieser Art, und ich fhlte mich berzeugt, das Gute zu wollen und zu knnen. Diese Grundstze hatte ich von meinem Grooheim, dem Kupferstecher Schmidt. Dieser h atte whrend seines langen jugendlichen Aufenthalts in Paris allen Versuchungen, k atholisch zu werden, herzhaft widerstanden. [76] Dies wollte ich auch tun, und wie das brige in Italien selbst werden knnte, d
as wollte ich bis dahin beruhen lassen. In Florenz mute ich bald die Sprache des Landes verstehn. Mein erstes Geschft sollte darinne bestehen, ein Gedicht zu eine r Oper zu erhalten. Dies wollte ich komponieren, und Aline sollte darin auftrete n. Alinens Mutter selbst mute mir, dem tapfern Befreier ihres Kindes, in allem be hilflich sein, was die Sprache und Sitte des Landes forderte. Auch mit dem Namen mute etwas vorgenommen werden. Hassens und Hndels Namen nannte man in Italien nic ht; jeder von ihnen war unter dem Namen il Sassone bekannt. Ich hatte schon frher m ir den Namen Cavallo di Napoli (welches einen Zelter andeuten sollte) ausgedacht; jetzt fiel ich darauf, mich Alino zu nennen. Dieser Plan nun war bereits aufgeschrieben. Mein Glck war mir so oft gnstig gewese n, da ich mein Papier schon in Alinens Hnden glaubte. Die nchste Andacht erschien, und ich fehlte nicht. Ich hatte ein grauseidnes Tuch gekauft, das Papier so oft zusammengelegt, als es sich tun lie, und in dies Tuch gewickelt. Als ich die Trep pe herauf kam, stand Aline oben allein; sie nahm das Tuch, gab mir dagegen ein k leines Zettelchen, und ich ging in den Saal. Ich nahm mein Gesangbuch. Es [77] w ard das Lied angekndigt: An den Flssen Babylon. Ich legte meinen Zettel ins Buch zum Zeichen des Liedes und las ihn gelegentlich. Es war darauf geschrieben: Morgen f rh gehe ich nach Wasser. Als das Lied gesungen wurde, schwammen meine Augen in Trne n; ich ward hingerissen vor Wehmut, und ein Gefhl schmerzlichen Anteils erfllte me in ganzes Wesen. Von jetzt an war mir's, als wenn der heimische Boden unter mir glhend sei. Die Nacht darauf hatte ich einen frchterlichen Traum: Mir trumte, ich sa an der Auf schwemme und wusch meine Fe. Die blaue Flut bewegte sich, und Aline stieg herauf u nd winkte mir; sie sah zrtlich aus, voll Liebe und Gte. Meine Arme breiteten sich aus, sie aus der Flut zu retten. Meine Fe standen eingewurzelt in dem Boden, ich k onnte sie nicht aufheben. Erst sang sie himmlisch s, dann weinte sie, und zuletzt versank sie klagend und wimmernd in der Flut. Der Ton ihrer Stimme hallte in die Wolken und kehrte wie ein harmonischer Widerhall zu meinem Ohre zurck. Frh Morgens ging ich, um sie nicht zu verfehlen, zuerst nach der Aufschwemme. Von hier ging ich ihr langsam entgegen, bis ich nahe genug war, ihre Haustr zu sehn. Ich ging hin und wieder. Der Seiger schlug acht, neun, zehn, eilf, zwlf Uhr, die Tr ging nicht auf. Ich ward angst, ging zurck bis an die Aufschwemme, setzte mich auf einen Stein, der am Ufer lag, und blickte ins Wasser. Es ward Abend, Aline kam nicht. Die Nacht war entsetzlich. Am neuen Morgen tat ich meinen gestrigen G ang; Aline kam nicht. Sonntag ging ich in die Messe; sie war nicht zu sehn. Den Tag darauf kam der junge Stuckarbeiter zu mir [78] und sagte, seine Mutter l ie(e) mich bitten, ehe ich wieder in die Andacht ginge, zu ihr zu kommen. Ich ers chien sogleich, um nur etwas zu erfahren. Sie fing damit an, mir zu erffnen: Der Lehrer lie(e) mich bitten, in den Andachten nicht ferner zu erscheinen. Sein Haus sei ein Bethaus, ich aber wrde wohl wissen , was ich daraus zu machen gedchte. Wrde ich jedoch diese Bitte unerfllt lassen, so habe er bereits obrigkeitliche Maregeln getroffen, mich in meine Schranken zu ve rweisen. Auch meine Eltern sollten unterrichtet werden, wie weit es ihr Sohn in der schndesten Heuchelei gebracht habe, eine ganze Versammlung mit Krokodilstrnen zu tuschen, und dabei eine Geschichte erfahren, die die Krone aller Verfhrung sei. Ich stand wie eingewurzelt, ohne zu reden. Endlich sagte sie mit einiger Milde: W arum reden Sie nicht? Wissen Sie nichts zu Ihrer Rechtfertigung zu sagen? Ich ant wortete ihr: da sie und der Herr Lehrer die Beschaffenheit meines Herzens so gen au kenneten, um mich zu verdammen, so wre die Sache ja am Ende. Ich stehe hier vo r Gott wie sie; der wisse, ob ich ein Heuchler sei; dem knne ich's klagen und den drfe jeder fragen, was er wissen msse. Hier trat der Lehrer herein, der eine ernsthafte Amtsmiene annahm. Nein, mein jun ger Freund, sagte er mit Migung, so kommen Sie hier nicht weg; Sie mssen sagen, was S
ie wissen. Nun, versetzte ich, so mu ich doch erfahren, was Sie wissen wollen! Hab e, fragte er, Alinen verfhrt? Nein! Sind Sie von ihr verfhrt worden? Nein! Hause gewesen? Nein! Sind Sie auer der Andacht in meinem Hause gewesen?[79] Nein ein! Nein und wieder Nein! Haben Sie das Mdchen gesprochen? Ja! Wo? Auf der Stra ie ihr ein Papier zugesteckt? Ja! Was stand in dem Briefe? Es war kein Brief! in dem Papiere? Hier erwachte meine Entschlossenheit: Wenn ich Ihnen, versetzte ich , sagen wollte, was in dem Papiere stand, so wrde ich es Ihnen gleich gesagt haben . Aline allein sollte es wissen und sonst kein Mensch. Lassen Sie mich gehen; Al ine ist unschuldig; ich bin unschuldig. Sie knnen versichert sein, da keine mensch liche Gewalt mir abzwingen wird, was ich verschweigen will! So empfahl ich mich u nd ging vor des Lehrers Hause vorbei der Kirche zu, wo ich Alinen bei der Wsche g esprochen hatte. Ich war etwa eine Stunde umhergeirrt, und kurz vor dem Mittagse ssen ging ich nochmals zu der schnen Frau, die ich allein fand. Ich beschwor sie, mir zu sagen, was aus Alinen geworden sei. Sie ist, sagte die Frau, ein verstocktes, unseliges Geschpf, und Sie sind der zweite , den sie angesteckt hat. Wissen Sie, sie ist eine Italienerin! Eine katholische , falsche Kreatur! Der Lehrer hat sie aus Milde und Menschenfreundlichkeit aufge nommen, und nun gibt sie ihm schon zum zweiten Male den Lohn. Sie hat das Papier verbrannt, doch die Beichte hat sie verraten. Sie ist sogleich fortgeschickt, u nd es hat sich eine Gelegenheit gefunden, sie ihrer Mutter zurckzusenden, die noc h leben soll. Bemhen Sie sich also nicht weiter; Sie werden sie hier nicht wieder sehn. Aus allem diesem konnte ich deutlich wissen, Aline hatte nichts von meinen Planen verraten, und nun kam sie mir erst recht erhaben vor. Sie hatte nichts ve rsprochen und doch nichts verraten; [80] in der Beichte war sie aufrichtig gewes en, ja sie hatte nur sich verraten; mich hatte sie geschont. Sie werden sie hier nicht wiedersehn! Diese letzten Worte der schnen Frau wiederhol te ich mir so oft, da ich zuletzt darauf fiel, sie knne deswegen doch wohl noch hi er sein. Ich lie es an keiner Mhe fehlen, mich zu erkundigen. Da sie in dem Hause d es Lehrers nicht mehr war und bei dem Pater Giovanni auch nicht, erfuhr ich fr ge wi. Vier bis fnf Wochen suchte ich sie unermdet, indem ich stundenlang des Morgens bei der Aufschwemme, des Mittags auf dem Trockenplatze bei der Kirche und nach T ische bei dem Grtner, welcher ein Bad zu vermieten hatte, ihrer harrete. Zuletzt mute ich meine Nachsuchungen einstellen und beruhigte mich endlich mit dem Gedank en, sie in Italien anzutreffen, ob ich gleich ihren Familiennamen nicht einmal w ute: denn sie hie auch nicht Aline. Im Hause ihrer Herrschaft nannte man sie Carol ine, und so hatte sie auch die Frau auf dem Trockenplatze gerufen. Mit Hackert hatte ich einen Briefwechsel verabredet, und um diese Zeit kam sein erster Brief aus Neapel. Ich habe diesen lieben Brief unzhlige Male gelesen, gekt, an mein Herz gedrckt und mit Trnen der Sehnsucht benetzt. Hackert schrieb mir dari nne, da er mein gedenke, so oft er die groe Menge altertmlicher Wunderwerke der Kun st betrachte, womit Italien wie beset wre; da er eigentlich dort keinen Menschen ha be, dem er seine Gedanken und Empfindungen ausschtten knne. Mit den Neapolitanern knne er noch nicht viel reden, und mit den meisten Deutschen hier zu Lande wrde er so bald fertig, da er sich immer lieber gar nicht auf ernsthafte Gesprche einlass en mchte. Ich sei es, der [81] ihm hier fehle, um seinem Herzen Luft zu machen, u nd es tue ihm aufrichtig leid, seinem Bruder von Berlin aus nicht sogleich den V orschlag getan zu haben, mich mit nach Italien kommen zu lassen. Sein Bruder sei ein groer Knstler, der nur mit groen und gemachten Knstlern umgehe; gegen ihn sei e r ernsthaft, streng und ohne Ergieung. Das Jahr 1777 war gekommen, und seit der Zeit meines Gesellenstandes war auer der Musik so viel als nichts geschehen. Mein Vater verlangte nun von mir, da ich die Musik auf eine Zeitlang gnzlich sollt e ruhen lassen, um mich ganz und ernsthaft den Baugeschften zu widmen; besonders aber sollte Zeichnen und Geometrie zur Tagsordnung gehren.
Dies alles nun geschah wirklich, wie es befohlen war oder wie es gehen wollte. E s wurde ein besonderer Instruktor angenommen, der mich tglich in der Trigonometri e und Mechanik unterrichtete. Da mir nun das Maurerwesen immer mehr zuwider wurd e, so beschlo ich, mich auf den Wasserbau zu legen, wogegen mein Vater nichts ein wendete. Es war der Professor Wagner, der mich in allen diesen Dingen unterricht ete. Er war ein geschickter und berhmter Mann, von groer Geflligkeit gegen seine Sc hler, welches letztere ich mir sehr bald zunutze machte, indem ich auf meine trig onometrischen und algebraischen Hefte neben mathematischen Figuren musikalische Liniensysteme und Melodien hinzeichnete, die ich ihm zu seinem groen Erstaunen vo rsang, und worin er dann die Zeichen musikalischen Genies an mir erkennen wollte , obgleich er selber keine musikalische Ader in sich trug. [82] Wagner wohnte in dem Hause eines Planetenlesers oder Wahrsagers namens Paul , welcher letztere mit dieser Spekulation ein sehr eintrgliches Gewerbe trieb und daher gemchlich lebte, wenn hingegen jener als ein wissenschaftlicher Mann sich sehr einrichten mute. Daraus entstand ein sonderbares Verhltnis, insofern Paul sich gern zu den unterri chteten Leuten zhlte, und Wagner sich Pauls guten Tisch gefallen lie, wodurch denn Verwechselungen entstanden, indem Leute zu Wagnern kamen, um sich wahrsagen zu lassen. Dieser Paul war sonst, wenn ich nicht irre, ein Weber gewesen und fhrte d aher alberne Reden, wenn er von seiner jetzigen Wissenschaft sprach. Ob ich nun gleich nach diesem Hause keinen musikalischen Zug hatte, so wei ich do ch selber nicht, wie es zuging, da ich nicht ungern hinging. Vielleicht war es di e neue Lebensmethode, was mich reizte. Wagner und seine Frau, der er sehr zugetan war, wohnten mit einigen groen Hunden im obersten Stockwerk allein. Ihr Hauswesen war ganz unerfreulich wie ihre Armut , Unordnung und der ble Geruch, welchen die Hunde verursachten. Ganz unten wohnte der Wahrsager mit seiner Frau und einer mannbaren Tochter. Hie r war Ordnung und Reinlichkeit; doch schien es, als wenn dieser Mann zugleich au f Pfnder lieh, denn in zwei gar nicht gerumigen Stuben, worin ein groes Ehebett und einige groe eichene wohlausgeschweifte Schrnke standen, waren die ungleichartigst en Dinge an den Wnden, auf Tischen und Konsolen in groer Anzahl zu sehn. Ein Holzs chnitt, welcher eine Art von Portrt vorstellen sollte und sich der Manier nherte, wie die obere Seite eines Gewrzkuchens [83] gestaltet ist, hing neben der Tr. Daru nter stand: Paulus, Sortilegus Berolinensis. Mit diesem sogenannten Portrt bildet e sich Paulus ein, ein rechter Mann zu sein, und verga nicht dabei zu sagen, da de r Prinz von Oels ihn habe in Kupfer stechen lassen. Die Hausfrau war ein gutes k leines, auerordentlich breites Gewchs mit einer so groen Fettbeule am Halse, da sie beinahe zweikpfig erschien. Das Tchterchen aber von etwa vierundzwanzig Jahren war lang, mager, pockennarbig, weihaarig und hatte die schnsten Zhne, welche man sehen kann. Im mittelsten Stockwerke wohnte ein junger Feldmesser von etwa vierundzwanzig Ja hren, der sich hier eingemietet hatte, um Wagners Unterricht zu genieen und sich beim Oberbaudepartement examinieren zu lassen. Wagner hatte einen groen Ruf, und bei der unordentlichen Lebensart nahm er vielle icht fter mehr Lektionen an, als der Tag Stunden hat. Er lie sich das Unterrichtsg eld gerne vorher bezahlen, und wenn der Schler kam, fand er oft die Tr verschlosse n. So rgerlich dies war, so war es zugleich spahaft, wenn zwei oder drei Schler an die Tre traten und solche verschlossen fanden. Es hie dann, Wagner sei ausgegangen , obgleich er zu Hause war und dem Vierten die Lektion gab. Man kam zuletzt hint er die Sache; denn war er zu Hause, so waren die Hunde still, welche allein und eingeschlossen einen entsetzlichen Lrm machten, sowie jemand klopfte. Sammelten s ich nun mehrere Schler vor seiner Tr, so blieben diese beisammen auf der Treppe un d trieben ihre ganze Stunde lang fr ihr Geld allerlei Possen. Wagner aber, um sei
ne Gegenwart nicht zu verraten, hetzte dann die Hunde, da sie bellen muten, und wi e man auch [84] dies merkte und nun die ganze Stunde gepocht wurde, so schlugen auch die Hunde unaufhrlich an, so da die drinnen auch nichts Ernsthaftes vornehmen konnten. Zuweilen war das Spektakel so scheulich, da die Nachbarschaft in Aufruhr kam und der Wirt in seiner prophetischen Geschftigkeit gestrt wurde. Heiland, so hie der Bewohner des zweiten Stockwerks, war eines reichen Mllers Sohn aus der Provinz, etwa zwlf Meilen von Berlin. Er mochte zur Feldmesserei so viel Luft haben als ich an der Maurerei, weil er doch am Ende des Vaters Mhle annehme n sollte. Dieser hatte sein Wesen mit der Tochter des Hauses, welches die Eltern zulieen, weil sie eine Heirat zwischen den jungen Leuten wnschten. Er war also un ten wohl aufgenommen und trieb viel Mutwillen, der ihm leicht verziehen ward, we il das Mdchen ihn berall in Schutz nahm. Da er ein lockerer Zeisig war und an alle m teilnahm, was ihn auf seine Art belustigen konnte, so kam der Lrm zuletzt so of t und nahm so berhand, da der Wirt Wagnern die Wohnung aufkndigte. Heiland aber wol lte dies nicht zulassen und erklrte, da er sich von Wagnern nicht trennen knne; dah er blieb die Sache beim alten. Heiland war von seinen Eltern sehr gut gehalten und erhielt wchentlich eine Menge Mundvorrat, weil diese glaubten, er wohne bei dem Professor. Er gab in seiner W ohnung kleine Gelage, ordnete Landpartien an, an denen, wo nicht Geschmack, doch eigene gute Laune das Beste war, weil immer Wagners und die Planetenleute dabei sein muten. Das Ende solcher auswrtigen Lustbarkeit bestand denn immer darin, da n eue Gste aus der Stadt geholt werden muten, die alten zu Hause zu fhren. [85] Als ich mich in diesem Wesen gegen zwei Jahre umgetrieben hatte, fing mir's an zuwider, oder vielmehr unertrglich zu werden, denn gefallen konnte mir's niem als, die Gemeinheit, die Wildheit und die Unreinlichkeit wie drei Fakultten unter einem Dache zu sehn, wobei so gar nichts herauskam; denn man konnte am Ende nic ht einmal darber lachen. Blo zuletzt ereignete sich etwas Sonderbares. Heiland hat te sein Examen bestanden, fing an, seltener und klter zu werden, und sprach von A breisen. Das Mdchen aber sprach vom Heiraten, von Mitnehmen, und die Sachen wurde n so ernsthaft, da Heilands Eltern davon unterrichtet wurden; ich glaube, das Mdch en hatte an seine Mutter geschrieben. Nun kam eines Tages diese Mutter angefahre n und hatte eine artige Frau mit einem jungen Kinde bei sich; aus den gegenseiti gen Umarmungen, Freudentrnen und Herzensergieungen ergab sich zuerst, da Heiland ei ne rechtmige Frau und ein Kind hatte. Die Bestrzung und Verwirrung ergriff das ganz e Haus ber dieser Entdeckung. Das Mdchen aber wtete und schimpfte auf die gemeinste Art, verga allen Anstand, und es kamen Dinge ans Licht, die noch niemand gewut ha tte. Ferner war Heiland noch vor kurzem in dem Hause eines Seifensieders bekannt worden, wo er als Erbe einer guten Mhle um die einzige schne Tochter frmlich angeh alten und das Jawort bekommen hatte. Auch diese Leute hatten einen gewaltigen Sc hreck, denn Heiland hatte versprochen, in diesen Tagen seine Braut nebst ihrer M utter zu seinen Eltern in die Provinz zu fhren, um dort die Verlobung zu vollzieh n. Alles dies verursachte gewaltige Bewegung. Heilands Mutter und seine Frau frch teten nur immer, noch nicht alles zu wissen und [86] beschleunigten daher die Ab reise. Am Morgen der Abreise erschien endlich noch eine Frauensperson mit einem Kinde und meldete ein neues Verhltnis an. Das Kind mochte ein halbes Jahr alt sei n, und Heiland bekannte sich gegen seine Mutter dazu. So schlo sich diese wunderliche Historie, bei der sich am Ende noch erklrte, da Hei lands Eltern ihren einzigen Sohn nicht eigentlich des Examens wegen nach Berlin geschickt hatten, sondern vielmehr deswegen, um ihn aus hnlichen, dort gesponnene n Verhltnissen herauszuziehen. Von hier kam ich nun um das Jahr 1779 zum Geheimen Oberbaurate Riedel, um brgerli che Baukunst zu lernen. Mein Vater behauptete: soviel msse ein jeder vom Wasserba u verstehn, sich das Wasser vom Leibe zu halten, aber ein gutes Haus und ein gut es Dach drauf zu bauen, sei auch eine Kunst, und man msse nicht im Sande Wasserba u treiben wollen. Demnach sollte ich nun brgerliche Baukunst treiben. Jetzt war m
ir auer der Musik alles einerlei, was ich trieb. Indessen fing ich hier ein ander es Leben an. Der Geheime Rat war ein guter Zeichner, malte in Ol und war im allg emeinen ein Mann von Geschmack, dem alles ansprach, was dem Schnen gem war. Die ers te Entdeckung, welche ich in seinem Hause machte, war ein altes Klavier, darauf spielte ein alter Jger, der Diener des Hauses, der Richter hie, einige Chorle. Sein Herr aber phantasierte ein wenig, suchte und griff Harmonien, wie sie ihm von o hngefhr gelangen. Hier konnte ich nun wieder dienen. Ich merkte, was sie suchten, und half ihnen. Da ich viel mehr spielen konnte als beide zusammen, so war ich eine glckliche Erscheinung in diesem Hause. Man hielt mich [87] fr einen Menschen von Genie, und da meine Zeichnungen, wenn ich mich nur daran hielt, ertrglich aus fielen, so war ich hier geschtzt und in einer nicht schlechten Lage. Der Geheime Rat, der oft auswrtige Baukommissionen hatte und sich eben so ungern von mir tren nte, als ich (mich) von ihm, nahm mich mit sich. Hier kam ich an die Luft, lernt e, was man Praxis nennt, die Huser guter Domnenbeamten kennen, und meine Musik lie es mir nirgend an Freunden fehlen. Eine dieser Kommissionen war mir besonders me rkwrdig. Sie bestand in Revision und Abnahme eines nach einem Brande ganz neu auf gebauten Kniglichen Domnen-Amtes. Gleich den Tag unserer Ankunft daselbst sahe ich die lteste Tochter des Hauses wi e eine Sonne an mir vorbergehen. Sie mochte sechzehn Jahre alt sein. Es war, als wenn das Licht aller Planeten in mir aufging. Ich trug die Akten vom Wagen in di e uns angewiesene Stube, worin vier weie Wnde, zwei Betten, ein Tisch und drei Sthl e standen. Das Bild des Mdchens lag mir in Gedanken; ich war heftig ergriffen wor den. Man rief uns zum Abendessen. Hier fand ich den Amtmann, einen voll- und wohlgewachsnen Krper, seine Frau von e twa vierzig Jahren mit einem von Pockenflecken bedeckten Gesichte, woraus zwei r uhige blaue Augen und die geflligste Weiblichkeit hervorsah; einen nicht ganz jun gen Hauslehrer, der fr mich gar kein Gesicht hatte, eine Erzieherin ohne Erziehun g und die smtlichen Schreiber und Wirtschaftsleute des Amtmannes. Die Erzieherin nahm bei Tische das Geschft auf sich, die jungen Leute aufzuziehn, die dann, bald einer bald der andere, so replizierten, da ich sogleich von der Achtung dieser H ausgenossen gegeneinander [88] aufs vollkommenste unterrichtet war. Der Hofmeist er unter hielt sich mit dem Amtmann, der am Tische sa und anstatt des Essens Taba k rauchte, ber die Pferde und Fohlen, lobte den Schimmel, den er nach Mittage ger itten hatte, und sprach mit groer Verehrung von dem Scharfrichter, welcher die Fu chsstute vom Kropfe kuriert hatte. Die Hausfrau legte das Essen vor und go den Gst en Wein ein. Nach dem Essen gingen wir auf unsere Stube. Der Geheime Rat entdeckte mir ie Ursache, warum der Amtmann ihn kaum wie sonst bewillkommt habe: Es sei ahrscheinlich von allerlei Kontraventionen die Rede, und es sei ihm nicht nehm, wenn der Amtmann so wenig als mglich sein Herz zu bestechen suche; gebundner knne man die Sache untersuchen und den Dienst versehn. hier d hier w unange desto un
Wir legten uns nieder; als ich nach einer Stunde noch nicht eingeschlafen war, s tand ich auf, zog mich wieder an, ging in der heitern Nacht im vollen Monde vor dem Hause unter Bumen auf und nieder und hrte den Nachtwchter, der die Stunden abri ef, mit einer vollen, hchst anmutigen Tenorstimme geistliche Abendlieder singen, wie es hier Gebrauch war. Am andern Morgen fing das Geschft an. Es fand sich bald genug allerlei, das nicht zu vertreten war, und die Stimmung verzog sich immer mehr. Man sprach von Neide rn und Anschwrzungen; der Hofmeister mischte sich in die Untersuchung, sprach von Aufhebens um Kleinigkeiten. Der Revisor hrte blo und antwortete nicht, und ebenso wenig der Protokollfhrer, denn das war ich. So kam der erste Mittag heran. Es war Sonntag. Der Prediger a mit uns. Ich war whr end des Frhstckens [89] einen Augenblick in der Kirche gewesen und hatte einen Tei l der Predigt gehrt; der Prediger hatte mich gesehn. Ich dankte ihm fr sein herzli
ches Gebet am Ende seiner Predigt. Wenn wir nur erst, sagte er einen bessern Kster ht ten; der Mensch ist imstande, mich mit seiner unangenehmen Stimme in meinem Vort rage zu stren. Ich sagte: Machen Sie doch Ihren Nachtwchter zum Kster; dieser singt j a so schn, da einem das Herz aufgeht. Der Amtmann sah mich mit vollen Augen an: Der junge Mensch hat, so wahr Gott lebt, recht, sagte er. Alles im Dorfe erfreut sich an dem Gesange des Nachtwchters, und jeder schimpft auf den Kster, und noch hat ke iner von uns allen an das Natrlichste gedacht. Dazu kommt, da der Nachtwchter eine gute Hand schreibt, Kenntnis von der Wirtschaft hat und niemals in den Krug geht wie der Kster, der lieber bei der Flasche ist wie in der Schule. Hier war nun auch die Tochter Bertha am Tische, die mich gestern so schnell eing enommen hatte. Vor dem Amtmanne stand Rheinwein, den er dem Geheimen Rat und dem Prediger einschenkte. Mir hatte der Hofmeister wie den brigen Tischgenossen rote n Wein eingegossen. Bertha nahm ein Glas, das vor ihr stand, go es voll Rheinwein , setzte es mir vor und sagte: Das ist dafr, da Sie meinem lieben Nachtwchter das Wo rt reden! Mein Vater sagt zwar, es htte noch keiner daran gedacht, den Nachtwchter zum Kster zu machen; ich habe wohl daran gedacht, aber wer hrt darauf, was ein ei nfltiges Mdchen sagt?
Ich konnte mich kaum auf meinem Sitze erhalten vor Freuden, mein Lob von diesen lieben Lippen so unbefangen und wohlverdient aussprechen zu hren; dagegen [90] em pfing ich von der Erzieherin und dem Hofmeister Blicke, die mich wieder in meine Fassung brachten. Nach Tische trat ich zur Hofmeisterin, kte ihre Hand und sagte, ich she dort einen Flgel stehn und bte sie, etwas hren zu lassen. Ja, sagte sie, ic ehre die Kinder spielen und singen, aber Mademoiselle Albertine ist mir ber den K opf gewachsen; wenigstens glaubt sie es. So setzte sie sich hin und spielte ein R ondo auf dem ziemlich abgespielten Flgel, worber ich sie sehr lobte und etwas von ihrer Gunst gewann, denn nun sprach sie doch auch mit mir. Bertha trat herzu und verlangte, da ich spielen sollte. Ich sagte, dies wolle ich gern, doch vorher solle sie mir erlauben, ein Messer und Rabenfedern zu holen, um das Instrument zu bekielen, denn so wre es nicht mglich, darauf zu spielen. Ach, wie glcklich sind Sie, sagte sie, diese groe Kunst zu verstehn! Wir mssen immer eine n Wagen nach der Stadt schicken, um den Stimmer zu holen, und manchmal reien die Saiten oder verstimmen sich wieder, gleich wie er fort ist. Ich bot mich an, diese Kunst ihren Nachtwchter zu lehren, wenn er Lust dazu htte, welches auch angenommen wurde. Nachmittags ging ich auf die Stube, um mein Journal in Ordnung zu bringen, unter dessen die Gesellschaft im Garten Kaffee trank. Der Amtmann kam mir nach auf die Stube und fing an zu reden: Sie scheinen mir ein wackrer junger Mann zu sein, un d so nehme ich keinen Anstand, Ihnen folgendes zu erffnen: Ich bin von Neidern we gen der Fhrung der neuen Gebude angeschwrzt; das wute ich, ehe Sie kamen, und jetzt merke ich, der Geheime Rat sinnt auf Kleinigkeiten, um den [91] Verdacht zu bestt igen. Wie kann man glauben, ich werde mir selber schlechte Gebude bauen, da ich d as Amt behalten will, um die Kammer um einige armselige hundert Thaler zu betrgen ? Der Bau ist noch nicht ganz fertig, also weder abgenommen noch bergeben, und ma n kommt schon mit einer Untersuchung. Sagen Sie selbst als ein verstndiger Jngling , ob dies recht ist? Ich antwortete, da ich hier kein Recht zu sprechen htte. Die Instruktionen des Geh eimen Rats kenne ich nicht, ich wre in meiner Pflicht, und es wrde mich unglcklich machen, in einem so lieben Hause ein unangenehmes Andenken zu hinterlassen. brige ns irre er sich vollkommen in dem Charakter des Geheimen Rats, der ein ernsthaft er, billiger, liebenswrdiger Mann sei, aber doch seine Sendung erfllen msse. Mit di esem solle er offen und frei reden, und ich sei versichert, er werde mich loben, wenn er meinem Rate folgte. So ging er aus der Stube. Die Sache aber war, wie sich nachher zeigte, folgende. Der Amtmann war ein Liebh
aber schner Pferde, mit denen er Handel trieb. Er lie also den Stall fr diese Tiere zuerst bauen und aufs kostbarste einrichten. Dies hatte Aufsehn gemacht, und de swegen hatte man geglaubt, der Amtmann liee die andern Gebude schlechter bauen, um jene mehrern Kosten zu decken, und ihn also beim Minister verklagt. Ehe ich jedoch dies letztere wute, ward mir sehr bang ums Herz. Ich nahm Anstand, dem Geheimen Rat meine Unterredung mit dem Amtmanne zu berichten. In einem Haus e, wo ein so schnes Mdchen wohnte, sollte ich ein so fatales Geschft vollbringen he lfen? Dies tat mir weh! [92] Manches hatte sich schon gefunden, und das Schlimms te, frchtete ich, msse nachfolgen. Vor dem Abendessen ging ich vor dem Hause unter den Bumen auf und ab. Bertha trat in die Haustr; sie nherte sich, und wir gingen zusammen. Sie erzhlte mir, der Vate r sei eben mit dem Geheimen Rate in lautem Wortwechsel begriffen; sie wisse gar nicht, was das bedeuten solle; die Mutter weine, und das ganze Haus sei auseinan der; ich solle doch den Geheimen Rat zu beruhigen suchen, sie wolle den Vater be wegen. brigens sei der Nachtwchter gekommen, sie habe ihn rufen lassen, und ich so lle ihn lehren den Flgel bekielen. Alle diese Dinge wirkten, ich wei selber nicht was, bei mir; ich war in entsetzlicher Herzensangst. Der Nachtwchter war ein Mensch von zweiunddreiig Jahren und sah wohl aus. Ich fand ihn so gelehrig und anstellig, da ich ihn bald fragen mute, wie er hier zu diesem Dienst komme und darinne beharrte. Er versetzte, er wolle mir dies auf den Aben d erzhlen; um zehn Uhr ginge er singen, und wenn ich mit ihm sein wolle, so wolle er mir die ganze Nacht erzhlen. Ich bestellte ihn auf einen andern Tag wieder, u m ihn ferner zu unterrichten, und er ging von dannen. Ich ging nun auf die Stube zum Geheimen Rate und erzhlte ihm meine Unterredung mi t dem Amtmanne, und da ich fr Pflicht hielte, ihm solches wiederzusagen. Dieser wunderliche Mensch, sagte der Geheime Rat, sieht in mir durchaus nichts als den Feind seines Hauses; er tritt in die Stube, fhrt daher und sagt Bitterkeiten b er mein Amt, als wenn er der schuldigste Mensch wre. Ich wei nicht, was er will, d enn ich bin im stillen berall schon umhergestreift und finde mehr zu loben [93] a ls zu tadeln. Der Stall ist freilich kostbar gebaut und grer, als er zu sein brauc ht, doch ist an den andern Gebuden nichts erspart oder weggelassen. Ja, ich bin d er Meinung, er ist aus Neid angeschwrzt. Aber ich mu doch untersuchen; die Sache m ag ausfallen, wie sie wolle. Wenigstens von seiner Seite ist an gar keinen Betru g zu denken, und was die Werkleute versehn haben, sollen sie verbessern, ehe ich von hier gehe. Sie aber, fuhr er fort, werden auch zu flicken haben: an Ihrem Her zen, wenn Sie von hier weg sind. Ich merke, die Mademoiselle Albertine, die Sie sich schon zu einer Bertha getauft haben, hat Ihnen einen schnen Stich beigebrach t. Wenn der Minister merkt, da wir uns hier verliebt haben, ist er imstande, eine zweite Untersuchungskommission herzuschicken. Ich war ausgelassen vor Freuden ber des Geheimen Rats Gesinnung gegen den Amtmann , doch eben so sehr erschrocken ber seine Entdeckung, denn er sagte mir, was ich mir selber noch nicht gesagt hatte: ich liebte! Ja, ich liebte die schne Bertha; nun war mir alles klar, und alle meine Angst fiel von mir wie Blei; ich flog wie ein Vogel davon. Mein erstes Geschft bestand darin, Bertha aufzusuchen; sie war lange nicht zu fin den, endlich kam sie von der Tochter des Predigers. Ich sagte ihr meine Neuigkei t, welche jedoch nicht den erhofften Eindruck machte, da sie von einer kranken F reundin kam, fr die sie sehr besorgt schien. Die Revisionsangelegenheit war endlich zur Zufriedenheit aller Teile beseitiget, doch der Minister hatte dem Geheimen Rat aus der Residenz geschrieben, da er ihn hier abholen werde, um die umliegenden mter zu bereisen, [94] und bis dahin also muten wir hier bleiben und hatten wenig zu tun. Eines Morgens kam mein Nachtwchte
r, der Martin hie, zu mir. Ich habe Sie, sagte er, alle Abend erwartet; es kann sein , da Ihnen an meiner Geschichte nichts liegt; doch mir liegt daran. Sie gehen doc h nach Berlin zurck und knnen mir, wenn Sie wollen, einen Dienst tun.
Er erzhlte nun, er sei eines Landpredigers Sohn aus Westfalen. Whrend seiner Studi en in Halle habe er nach fnfzehn Monaten Streit mit einem andern Studenten wegen eines Mdchens bekommen. Er habe ihn am Kopfe verwundet, der Mensch aber habe verd orbene Sfte gehabt, die sich auf seine Wunde geworfen, und nach zwei Monaten sei jener gestorben. Sein Vater sei ber diesen Zufall untrstlich, wolle ihn nicht mehr sehn und ihn enterben. Er habe flchtig werden mssen und sich, da er alle Land- un d Feldarbeiten verstehe, von Dorf zu Dorf als Drescher oder Knecht bis hieher um getrieben, wo er nun seit einem Jahre Nachtwchter sei und sich den Augen der Welt also am leichtesten verbergen knne. Er wohne hier in dem Hause eines Tagelhners, wo er am Tage Vogelkfige schnitze und Felgen zu Wagenrdern aushaue. Der Amtmann ha be ihn gestern gerufen und ihm gesagt, da er nchstens Kster werden solle; er habe d arauf nichts geantwortet, bestn(de) aber der Amtmann darauf, so msse er auch von h ier wieder fortgehn. Nun sei er auf den Gedanken gekommen, sich mir anzuvertraue n. Er hoffe, ich werde dies Vertrauen nicht mibrauchen und ihm eher ntzlich als sc hdlich sein. Sein Leben sei ihm lngst zur Last, da er jedoch von einer Mutter zrtli ch geliebt werde, die er nicht betrben wolle, so habe er beschlossen zu leben, so lange es gehn [95] wolle. Kurz vorher, ehe Sie kamen, fuhr er fort, war ich willen s, Bertinchen meine Sache vorzutragen, da sie ein treffliches Mdchen ist und mir schon viel Gutes getan hat; doch frchtete ich, sie mchte es ihrem Brutigam wiederer zhlen, den ich nicht leiden kann, weil es ein gar zu massiver Menschensohn ist, d er durchaus kein Interesse nimmt als an Weizen, Haber, Gerste, Khen und Pferden. Er mag brigens ein guter Wirt sein und Vermgen haben, das Mdchen aber ist etwas Bes seres wert. Wie! rief ich aus, Bertha ist verlobt! Ja, sagte er, schon seit Oster Pfingsten kommt er wieder her. Er ist einundzwanzig Jahre alt und scheint sich g ar nicht sonderlich um das Mdchen zu bekmmern. Da er dem schnen, reinen Wesen so na he ist, knnte er wenigstens alle Woche einmal kommen, doch er kmmt nicht als wenn er wei, da der Amtmann ein neues Pferd im Stalle oder neue ostfriesische Khe hat, u nd dann ist, sowie er vom Pferde steigt, sein erster Weg zum Stall; nach dem Mdch en fragt er kaum. Es war mir kaum mglich, die zerreiende Bewegung meines Busens zu verbergen. So jung noch, sagte ich, und schon in Bande, schon in Gefangenschaft? Ja, sagte er, das ist ier nicht anders. Auf dem Lande ist solch ein Mensch was wert, und der Amtmann h at ihn gern; er kauft kein Pferd, Kraft (so hie der Brutigam) mu es erst reiten. Wa rum ich ihn nicht wohl leiden kann, ist, weil er nichts schtzt, als was er brauch en kann; alles andere ist fr ihn nicht in der Welt. Ich hatte, fuhr er fort, einen Nachtigallkfig sauber geschnitzt und brachte ihn der Bertinchen am Ostermorgen mi t einer herrlichen Nachtigallen. Das Kind machte ihn aufmerksam auf die fleiige A rbeit und den schnen Gesang des [96] Vogels. Ein Schwein auf dem Koben und die Nach tigall auf dem Baume, sagte Kraft, she ich lieber! Er hatte sich einen Wagen in Fran kfurt machen lassen, der kam hier an und wurde allgemein bewundert. Da ich nicht s sagte, so fragte er mich: Nun, Martin, was sagst denn Du? Der Wagen, sagte ich, sie ht gut genug aus; ich mag das Pferd nicht sein, das ihn zieht; er geht schwer im Sande, und lange wird er nicht halten. Mach's besser, dummer Hans! rief er aus. Ein Vogelbauer ist es nicht. Du wirst solch einen Wagen nicht machen! Da machte ich mich dran, suchte mir das Holz aus und baute dem Amtmanne einen Wagen. Dieser ha t ihn beschlagen lassen und ist letzthin damit zum Schwiegersohn gefahren, der s einen neuen Frankfurter Wagen glcklich zerbrochen hat. Da hat denn Kraft gesagt: 'Das htte ich in dem Jungen nicht gesucht, da er das knnte; er soll mir auch einen Wagen bauen!' Doch das wird Martin bleiben lassen! Martin sagte mir nun ferner, er habe einen Oheim, der Kammergerichtsrat in Berli n sei; diesem solle ich melden, da er lebe und eine Vereinigung mit seinen Eltern wnsche. Zum Studieren habe er die Lust verloren, aber er wolle dem Vater die Wir tschaft fhren, da er mit ihm zufrieden sein solle.
Doch, fuhr er fort, Sie nehmen, wie ich merke, groen Anteil an dem Mdchen. Sie sind e rst wenige Wochen hier. Sie knnen hchstens zwanzig Jahre alt sein. Haben Sie dies Haus schon sonst gekannt? Ach! sagte ich, htte ich es niemals kennen gelernt! Ich ges and ihm, da der erste Anblick des Mdchens mich durch und durch ergriffen htte; da er mich in diesem Augenblick zu dem unglckseligsten Menschen mache durch seine [97] Nachricht. Dies tut mir leid, sagte er, aber erfahren muten Sie es doch. Doch htte i ch Ihnen das Mdchen gewnscht; sie ist Ihrer vollkommen wrdig. Und nun fuhr er wie ei n Strom fort, sich ber das Lob dieses Mdchens zu ergieen. Sie ist wie ihre Mutter, d ie ich trotz ihrer Narben schn finden kann, denn diese regiert das ganze Haus mit Liebe und Freude. Sie ist eine vollkommene Wirtin. Ich kenne nur eine, mit der sie zu vergleichen ist, das ist meine Mutter. Eine grere Kennerin des Gesindes als die Amtmannin ist mir nicht vorgekommen. Eine Magd, die sie in Dienst nimmt, is t auch gewi gut und wird alle Tage besser. Gehen Sie durch das ganze Haus, durch die Molkerei, ins Brauhaus, in die Brennerei, in die Kuhstlle, berall finden Sie O rdnung und Reinlichkeit. Dabei schilt und schimpft sie nicht; auf dem ganzen Amt e ist es ruhig. Aber, setzte er hinzu, was htten Sie denn auch mit dem Mdchen gewoll t? So jung Sie sind, ohne Amt, mit Ihrem Talente und in Ihren Aussichten mssen Si e jetzt, knnen Sie jetzt nicht heiraten. Htte ich Ihr musikalisches Talent gehabt, ich wre geradenwegs nach Italien gegangen, wozu ich eine sonderbare Neigung habe ; wollen Sie denn nicht nach Italien gehn? Ich erschrak, als der Mensch diese Sai te tnen lie. Wie kommen Sie, sagte ich, auf Italien? Wer hat Ihnen davon gesagt? Gebe n Sie mir Ihre schne Stimme, und ich gehe von hier dahin, ohne vorher zurck nach B erlin zu gehn, wo mir das Herz im Leibe friert. Aber Sie irren sich in mir. Ich bin allerdings nicht ohne Naturell und Trieb zur Musik, aber mein Spielen, welch es hier freilich hinreicht, ist noch zurck und wird niemals besonders werden, wei l meine Hnde schon vom Handwerke angegriffen sind. In der [98] Komposition ist no ch nicht viel, ja eigentlich gar nichts geschehen, denn ich habe keine ordentlic he Unterweisung darinne gehabt; was ich tue, geschieht aus angeborner Lust. Mein e Stimme ist schwach, und in Italien mte ich verhungern, schon deswegen, weil ich die Sprache nicht kenne. O, wenn Sie sonst keine Sorge haben, sagte er, so mssen Sie auch wissen, da man in Italien beinahe von gar nichts leben kann, und eine Sprach e lernt sich. Ich wte nur nicht, was ich da sollte. Von Deutschland, dachte ich, mte ich ganz weg; Gott wei, wo ich die Furcht hernahm, die mir sonst nicht eigen ist . Frankreich und Eng[el]land kann ich nicht leiden, das erste der Sprache wegen, und das andere des verfluchten Handels wegen. Da dachte ich, in Italien ist ein warmes Klima, und weiter fiel mir auch gar nichts ein; an meine Stimme dachte i ch nicht. Bertinchen hat mir auch gesagt, Sie htten meine Stimme gelobt, und ich mu gestehn, ich mchte wohl ordentlich singen knnen, denn meine ganze Kunst besteht in Liedern, die ich in Halle mit den Studenten gelernt habe. Ich kenne die Noten nicht. Als Martin fort war, kamen mir meine eigenen Gedanken wieder. Es war mir doch se ltsam, da Bertha auch nicht ein Wort von ihrem Brutigam gesagt hatte. Ich entschlo mich indessen, sie nicht zu fragen und die Sache in Geduld abzuwarten; doch woll te ich wissen, ob sie ihn liebte. Und wenn sie ihn nicht liebt? wird sie darum d ich lieben? wird sie berhaupt einen Mann besonders lieben knnen, sie, die von alle n geliebt wird, eben weil sie selbst gegen alles voll Liebe ist? Alle diese Frag en durchkreuzten sich in mir und taten wenigstens eine temperierende Wirkung auf meine erregte Leidenschaft. [99] Sonntag frh kam der Minister, den Geheimen Rat abzuholen. Es war nur ein Pla tz im Wagen, und ich mute zurckbleiben. Sie fuhren noch vor Tische wieder ab. Kurz vor der Mahlzeit kam unerwartet der Brutigam, der junge Herr Kraft an. Ich w ar in groer Bewegung; ich frchtete einen Auftritt, eine Explosion. Wie mir Martin gesagt hatte, so war es. Der Amtmann war auf dem Hofe. Kraft stieg ab, begrte sein en Schwiegervater, und sie gingen gleich in den Stllen umher und traten nicht ehe r ins Haus, bis das Essen aufgetragen war. So hatte ich Zeit, mich abzukhlen. Ich hatte eine Art von Ehrfurcht vor dem jungen Manne bekommen, indem er sein siche res Eigentum nicht vor meinen Augen in Besitz nahm. Er trat in die Stube und ver
neigte sich kurz gegen mich, nachdem mir ihn der Amtmann vorgestellt hatte, und man setzte sich an den Tisch. Ich wre, sagte er, nicht gekommen, wenn ich gewut htte, da der Geheime Rat schon wieder fort ist, denn diesen wollte ich um etwas fragen. Der Vater hat voriges Jahr eine Eisgrube bauen lassen. Sie ist nach dem besten Muster gebaut, aber wir haben schon jetzt kein Eis mehr, und ich wollte den Gehe imen Rat fragen, woran das liege. Ich fragte ihn, ob er mir das Gebude wohl genau beschreiben knne. Ich habe, sagte er, die Zeichnung mitgebracht, wonach sie genau is t gebaut worden. Er nahm sie aus der Tasche und gab sie mir. Ich sagte, gegen die Struktur wre nichts einzuwenden, jedoch wenn sich das Eis darin durch acht bis n eun Monate halten sollte, so mte sie wenigstens noch einmal so gro sein, weil eine so kleine Masse Eis sich nicht so lange halten knnte. Habe ich's nicht gedacht! rie f er aus. [100] Die Eisgrube, nach welcher diese Zeichnung genommen ist, ist gerade noch ei nmal so gro. Mein Vater aber sagte: Was soll ich mit alle dem Eise machen? Ich wil l das Gebude nur halb so gro haben. Und nun ist all[e] das Geld weggeworfen! Nach Tische ward allerlei vorgenommen. Bertha sang einige Lieder sehr artig. Der Hofmeister bat, sie mchte doch singen: Das ganze Dorf versammelt sich. Ach, sagte si e, damit verschonen Sie mich! Traurige Lieder mu man nicht singen, als wenn man tr aurig ist und allein. Mir wird allemal nicht wohl ums Herz, wenn ich ohne Not di e lamentabeln Gesnge hren mu. Ich mag gern Anteil nehmen, aber ich mu helfen knnen, u nd wer kann vergangne Schmerzen lindern? Das ist auch mein Sinn, sagte Kraft. Mich k ann's beinahe aus der Fassung bringen, wenn mich einer traurig machen will; man hat andere Sachen zu tun, als bei guten Tagen zu trauern. Der Hofmeister nahm wie der das Wort, indem er ausrief: Omnibus hoc vitium est cantoribus! Es wre nur die A rt aller Virtuosen, sich nicht hren zu lassen, wenn sie gebeten wrden; schon Horaz habe darber geklagt, und so sei es noch, und nun sprach er noch lang und breit be r das Kapitel. Nun, sagte Kraft, wenn denn Horaz es gesagt hat, so dchte ich, Sie hi elten das Maul! Tinchen hat gespielt und gesungen ohne Umstnde, und Ihre Predigt pat also nicht hieher. brigens mu ich gestehn, da ich auch nicht geneigt wre, jedem a ufzuspielen, der es verlangte; und wenn wir ehrlich sein wollen, denken wir viel leicht alle so, wenigstens handeln wir meistenteils so. Habe ich nicht recht? fra gte er, indem er sich gegen mich wandte. Ein jeder, sagte ich, hat recht, der ehrli ch sagt, [101] was er denkt. Es ist natrlich, da das, was einer kann, sich nicht z u allen Stunden gut hervorbringen lt. Wer dagegen aus Ungeflligkeit eine Geflligkeit ablehnen wollte, den knnte man billig tadeln. Das aber wrde unsere schne Bertha im mer nicht treffen, die ja das Gegenstck von aller Ziererei ist. Ja, sagte die Erzieh erin, wenn's drauf ankommt, der Mademoiselle Albertine das Wort zu reden, so rege n sich alle Zungen; diese mu nicht Unrecht haben! Nein, sagte Kraft, das mu sie auch icht, wenn sie unschuldig ist! Und Ihr wit alle beide nicht, wie solchen Menschen zu Mut ist, denn Ihr kennt nichts als Eure Bcher! Man fing an, ernsthaft gegen ei nander zu werden, und die Amtmannin sagte: Der Kaffee ist im Garten. Ich denke, w ir reden jetzt von etwas anderm! Und ich, sagte Kraft, werde zu Hause reiten, sonst wird es Nacht! So ging er und kam nicht wieder. Bertha begleitete ihn.
Der Kaffee ward im Garten getrunken. Bertha ging mit mir einen Gang auf und ab. I ch habe Ihnen, sagte sie, noch nicht gesagt, da Kraft mein Mann werden soll. Ist es nicht ein recht guter Mensch? Er gefllt mir ber alle Maen, antwortete ich. Ich bene ihn um vieles, aber ich mu ihn schtzen. O, sagte sie, wollen Sie wissen, was er von hnen sprach, da er sich aufs Pferd setzte? Das ist ein ganz anderer Junge , sagte e r wie der berweise Hofmeister. Ich kme gern fter her, aber dieser Mensch und die Mam sell knnten mich aus dem Himmel verjagen; ich kann sie alle beide nicht leiden; i hre Nase ist mir zu spitz und seine zu breit . Nun wute ich denn alles, was ich wissen sollte. Es berfiel mich eine Achtung gegen die beiden jungen[102] Leute, die sich so rein und wahr gegen einander verhielt en, wogegen mein entflammtes Herz eine traurige Figur machte. Diese jungen Leute , dachte ich, mssen sich von Tage zu Tage lieber und treuer werden, indem ihre an geborne Neigung wie ein guter Garten aufgeht, ohne heftige Leidenschaft durch Ze
it und Wartung wchst und durch's ganze Leben bestehn kann; ohne Sorge, wovon sie leben wollen, ohne Hindernis und Hehl fangen sie gleich das wahre Leben an, das sie fortsetzen und jeden Tag voll und unbewut genieen werden. Das Mdchen ist reif, zur Mutter, zur Wirtin erzogen. Der junge Mann wei, was er soll; liebt, was er ha t; er ist ein geborner Herr! Was bin ich dagegen? Eine unsichere Ttigkeit, ein na menloser, nimmersatter Trieb, eine versptete, ungeduldige Neigung und ein ewiges Hin- und Herreien lockt mich, schreckt mich, jagt mich. Martin besuchte mich jetzt fter; er ward mir immer lieber, denn er war ein treffl icher Mensch. Er hatte einen stattlichen Wuchs, ohne gro von Krper zu sein. Ein se iner Hieb auf der Backe, von der rechten Nster nach dem Kinn zu gab seinem Gesich te ein derbes Ansehn, das zu seinem brigen festen Knochenbau gut pate. Sein Vater wollte einen Theologen aus ihm machen und dachte, ihm seine sehr gute Predigerst elle, neben welcher er sich eine Erbpacht zugelegt hatte, zu hinterlassen. Marti n hatte Anlage zur Landwirtschaft gezeigt, welche der Vater eher untersttzte als zu hintertreiben suchte. Daher kam es, da er so geschickt in Feld- und Handarbeit en war und erst im zwanzigsten Jahre die Universitt bezog. Er gestand mir, da es i hm aufrichtig leid tue, in seinen Studien gestrt worden zu sein; er sei mit Genu a uf der Universitt gewesen und rate [103] jedem Menschen, der etwas sein wolle, ei nige Jahre auf solche Art zu verleben. Auch seine Mutter sei sehr damit zufriede n gewesen, die er ber allen Ausdruck liebe. Seine Augen strahlten, als er von sei ner Mutter sprach; ihr Lob rollte wie eine Siegessinfonie von seinen Lippen. Ich war entzckt ber die schne Liebe dieses Sohnes und nahm mir fest vor, ihm zu dienen . Nach einigen Tagen kam der Minister mit dem Geheimen Rat zurck. Er saheunser Revi sionsprotokoll durch, unterrichtete sich augenscheinlich von der Verfassung der neuen Gebude, lobte den Stall und die schnen Pferde und reisete ab. Nach einigen T agen gingen auch wir in Frieden und gutem Andenken nach Berlin zurck.
Bei meinem Abschiede fragte ich Bertha, ob wohl Kraft es nicht belnehmen wrde, wen n sie mir zum unvergelichen Andenken einen Ku mitgebe. Wenn es unvergelich sein soll, sagte sie, mu ich Ihnen wohl zwei geben, damit es vorhlt; auf Pfingsten ist unsere Hochzeit, dann denken Sie an uns oder kommen Sie lieber selber. Ich fuhr auf sie zu, kte sie in Inbrunst meines Herzens, und zum dritten Male auf die volle Brust. Nun, sagte sie mit grter Anmut, fr diesmal sei es genug, sonst mten wir Erlaubnis na uchen! So fuhr ich von dannen, und noch heute habe ich keinen Ausdruck fr die Wirk ung dieser Ksse. Bertha ist mir das Modell geblieben zu allem, was weiblich, schn und liebenswrdig ist; die vllig ausgewachsene Geistesgesundheit in einem so jungen , blhenden Krper, diese Erinnerung wird nur mit meinem Leben verlschen. Sie starb l eider im ersten Wochenbett an ungeschickter Behandlung, und wie ich gehrt habe, s oll Kraft untrstlich gewesen sein. [104] Gleich nach meiner Ankunft in Berlin suchte ich den Kammergerichtsrat auf. Er wute alles, nur Martins Aufenthalt nicht. Der Proze war entschieden. Der Tod d es Studenten war zwar die nchste Folge des Duells gewesen, doch hatte sich gezeig t, da alle Sfte des Patienten verdorben, und sein Tod auch ohne den brigens nicht td lichen Hieb so gut als gewi gewesen wre. Nur durfte Martin nicht wieder auf die Un iversitt kommen. Das brige konnte mit Gelde abgemacht werden, weil das Zeugnis der Professoren und der Eltern zu Gunsten des Angeklagten war. Ich war nun im Violinspielen ziemlich fortgeschritten, und seitdem ich eine gute Bratsche hatte, spielte ich auch Bratschenkonzerte, die man gerne von mir hrte. Dies veranlate viele Invitationen zu Konzerten, wobei ich zuletzt wie unentbehrli ch wurde, da ich auf drei Instrumenten Konzerte spielte. Dadurch lernte ich eine n jungen Juristen namens Sebaldt kennen, von dem ich bald unzertrennlich wurde, weil er ein trefflicher Musikus war. Er hatte weder eine schne Violine noch einen schnen Ton, aber er spielte rein und war der beste Anfhrer eines Liebhaber-Orches ters, denn er konnte mit sehr mittelmigen Leuten, wenn sie nur willig waren, die b estmglichste Musik machen.
Durch Sebaldt wurde ich in einem Hause bekannt, das aus zwei Brdern und einer Sch wester bestand, die smtlich unverheiratet waren. Die Brder bliesen beide Flte, die Schwester, ein nicht ganz junges, aber krftiges Mdchen mit den schnsten schwarzen A ugen und Haaren, bewirtete sehr artig solche Gste, mit denen ihre Brder Musik trie ben. Es gefiel mir bald in dem Hause, das ich denn auch oft genug besuchte, wo m an jeden [105] Abend wenigstens ein Trio haben konnte. Sebaldt liebte das Mdchen, das konnte ich bald merken, aber die Sache mute traurig enden, indem der gute Me nsch von einer Gesundheit war, welche sichtbarlich abnahm, bis er zu meinem groen Leidwesen starb. Kurz vor Sebaldts Tode hatte sich in dem Hause ein Protonotarius des Kammergeric hts eingefunden, ein kleiner, freundlicher Mann von Vermgen, mit dem sich's gut l eben lie. Er bezeigte sich artig gegen das Mdchen, und nach Sebaldts Tode lie er ni cht bel merken, da er Absichten auf sie habe. Anfnglich war mir's, als ob ich dies b elnehmen mte, da ein solches Mnnlein unter meinen Kanonen ein Mdchen zu kapern gedchte , an die ich wohl nhere Rechte geltend machen knnte. Hier fiel mir Martin ein und unsere Unterhaltung ber Italien; daher fing ich an, seltener zu werden, doch die schnen, groen Konzerte, welche hier eine Woche um die andere gegeben wurden, und d ie ich nach Sebaldts Tode dirigierte und sehr sorgfltig einrichtete, zogen mich i mmer wieder dahin. Ich sahe wohl ein, da das Mdchen, die einige Jahre lter war als ich, auf etwas Gewisseres zu denken htte; ich entschlo mich, zu resignieren und fi ng an, auer den groen Konzerten sparsam zu erscheinen. Dies mute bald bemerkt werde n, und so oft ich hinkam, fand ich das Mdchen ohne ihre sonstige Heiterkeit, an d ie ich mich sehr gewhnt hatte. Noch ein Umstand ereignete sich hier: die drei Geschwister lebten von dem Ertrag eines sehr eintrglichen Monopols; dieses Monopol war angegriffen worden, und die Brder standen eben auf dem Punkte, den darber gefhrten Proze zu verlieren. Der Protonotarius konnte dies wissen. War nun dies [106] die Ursache oder nicht, genug, auch dieser zog sich zurck, und das wackere Mdchen stand auf dem Punkt, ku rz nacheinander den dritten Liebhaber zu verlieren. Der jngste Bruder, auf den ich am meisten hielt, kam eines Tages zu mir und erffne te mir den Zustand seiner Schwester; sie wre trostlos, mich dadurch beleidigt zu haben, dem Protonotarius mit Gte begegnet zu sein. Sie habe ehedem an mir eine st ille Neigung zu finden geglaubt, und sie knne den Schmerz nicht erleben, wenn ich mich im Ernst entfernen wolle. Ich sagte dem Bruder ganz aufrichtig, da ich von der Zeit an, als der Protonotarius sich gezeigt und Eingang gefunden habe, mich schicklicherweise entfernt htte aus Respekt fr das Glck seiner Schwester. Ich sei e inige Jahre jnger als seine Schwester und habe einen weiten Weg vor mir, bis ich ein Haus halten knnte; da ich es aber gewaltig belnehmen wrde, wenn der Protonotariu s geglaubt habe, unter meinen Augen sein Spiel zu treiben mit einem Mdchen, die b illig von jedermann verehrt wrde. Am andern Morgen ging ich selber zu dem Protonotarius. Ich begegnete ihm mit Ehr furcht, doch als einem Freunde. Das Gesprch lenkte sich bald; er wurde vertraulic h, und ich erfuhr seine wahre Meinung. Das ist nicht schn, sagte ich und erklrte ger adehin, da ich aus Respekt gegen das Glck des Mdchens ihm Platz gemacht und ein and eres Verhltnis bezogen htte, weil er ein vollkommener Mann sei, einen ehrenvollen Dienst und eine gute Lage htte. Er habe, sagte er, bis jetzt einen Teil seiner Ei nknfte von seinem Vater bezogen, der ihm jedoch angekndigt habe, da er wegen groer V erluste nicht mehr das an seinem Sohn tun knne, was er bis daher getan. Daher knne er kein Haus [107] machen, und so weiter. Ich sagte, diese Wohnung ist vollkomm en gro genug fr zwei, fr drei, ja fr mehrere menschliche Wesen. Das Mdchen sei eine t reffliche Wirtin, und er werde gewi mit ihr weniger brauchen, als wenn er ohne Ha us lebe. Trte er zurck, so sei das Mdchen ldiert, welches ich nicht ruhig mit ansehn knne; ich ward zuletzt warm genug, um dem kleinen Manne durch feste Worte zu imp onieren, worauf er sagte, er wolle sich bedenken. Was!, antwortete ich, bedenken wi
ll sich ein dreiig jhriger Mann, der heiraten mu und will, ber ein kstliches Mdchen, d as er seit einem Jahre kennt und umgibt? Nein, mein Freund, tun Sie Ihre Schuldi gkeit und geben Sie mir Ihr Wort! Das Mdchen mu Ihre Frau werden! Ich erreichte meinen Zweck, und nach vier Wochen war die Hochzeit, der ich jedoc h nicht beiwohnte, weil ich verreiset war. So viel ich wei, leben die Leute noch glcklich miteinander, und ihre Shne sind versorgt. Seit Sebaldts Tode war ich nun Direktor aller Konzerte an seiner Stelle worden, in denen ich mit ihm zusammen gewesen war. Diese Konzerte zeichneten sich dadurc h aus, da das Ganze kein bloer liebhaberischer Zeitvertreib war, sondern auf ernst hafte knstlerische Beschftigung deutete. Unter unsern musikalischen Husern befand sich ein Destillateur namens Radicke, de r sich neben seinem Erwerb mit dem Orgelbau beschftigte und auerordentlich sauber arbeitete. Seine Orgelpfeifen, seine Klaviaturen, die er alle eigenhndig machte, waren daher Muster der Nettigkeit. Er war lngst mit den besten Instrumentenmacher n befreundet und sahe diesen ihre Mensuren und uere Handgriffe ab. Er bauete sich einen groen Konzertflgel [108] mit drei Klaviaturen, der einen vollen, schnen Ton hr en lie und eine Menge Vernderungen hatte. Seinen Sohn lie er im Klavierspielen unte rrichten, soda dieser ein leichteres Konzert nach seiner Art abspielen konnte. Da raus entstand ein kleines Konzert in dem engen Hause, das anfnglich in jeder Woch e einmal abgehalten wurde. Zu diesem Konzerte fand sich auch ein Mhlenbescheider namens Bruwill ein. Dieser stille Mann hatte sich seine Violine selber gemacht und nachher auch selber, ohn e mndliche Anweisung, darauf spielen lernen. Das Instrument war nach einem schnen italienischen Muster vollkommen nachgearbeitet. Er spielte rein, hatte einen gut en Ton und lernte in diesem kleinen Kreise bald seiner Stimme so vorstehn, da er brauchbar genannt werden konnte. Dieser wohnte in der Werderschen Wassermhle ganz oben unter dem Dache mit seiner Frau und einer etwa achtzehnjhrigen Tochter. War nun Radicke ein sauberer Nacharbeiter im Kleinen und schnitzte allein und la ngsam an seinen Arbeiten, so war Bruwill ein Mann, der eine Mhle von sieben Gngen beschaffte und tchtige Mllergesellen bildete. Der ganze Stil dieses Mannes war dah er derber, einfacher, man knnte sagen: tiefer. Radicke hatte, ehe er seinen groen Flgel anfing, einen kleinen zur Probe gemacht, der ihm ganz wohl gelungen war. Bruwill beschlo, auch einen Flgel fr seine Tochter zu bauen. Er hatte unter den Instrumenten, die er zum Muster aufsuchte, einen gr oen Orchesterflgel vom alten Silbermann entdeckt und sogleich die sichere Meisters chaft daran wahrgenommen. Nach diesem Muster arbeitete er nun einen dreichrigen F lgel mit [109] zwei Klaviaturen aus. Er war nicht so gro als der, den Radicke gema cht hatte, aber der Ton war noch schner. Nun lie auch dieser seine Tochter im Spie len unterrichten, die bald groe Fortschritte machte, weil sie ein ausgezeichnetes Talent besa. Bruwill, dem das Konzert in Radickens Hause zu kleinlich sein mochte, indem in e iner engen Stube die Instrumente nicht austnten, hatte auf dem Dache seiner Mhle n och einen Raum ausgemittelt, der am besten zu einer Stube genutzt werden konnte. Diese Stube wurde so gro als mglich mit Brettwnden eingerichtet, und bald stand ei ne artige Konzertstube da, deren Wnde mit musikalischen Sinnbildern geziert waren . Nun wurde das Konzert wechselsweis eine Woche hier und eine Woche in Radickens H ause gegeben. Die neue Stube war mehr als noch einmal so gro, und die Bretterwnde taten auch das ihrige, einen bessern Klang zu geben. Die ganze Musik bestand hier in fnf Violinen, zwei Bratschen, zwei Violoncellen, einem Kontraviolon, zwei Flten und dem Flgel. Sebaldt, der groe Lust daran hatte, g
ab sich groe Mhe. Er hatte von dem berhmten Dresdner Orchester gehrt, da der dasige K onzertmeister Pisendel jede Stimme durch seine Hand gehen lie, ehe sie aufgelegt wurde; dann bezeichnete er sie genau mit Auf- und Abstrich, mit piano und forte und allen Modifikationen, und hielt darauf, da das ganze Orchester diese Zeichen befolgte. Daraus entstand, da der Komponist jedesmal seiner Wirkung gewi war. Man brauchte weniger Proben; die Artisten spielten mit Lust und Kraft, und die Kenne r behaupteten, da alle Violinbgen im Dresdner Orchester zugleich auf- und abgingen , und hierauf [110] grndet sich der damalige Ruhm des Dresdner Orchesters. Dies sollte nun auch unter uns erreicht werden. Sebaldt bezeichnete die Stimmen. Schwere Stellen wurden so oft[e] wiederholt, bis sie gut hervortraten, und in e inigen Jahren hatte sich hier unter dem Dache der Werderschen Mhle ein musikalisc hes Ensemble gebildet, das endlich die Aufmerksamkeit einiger Kenner auf sich zo g. Der Konzertmeister Joseph Benda und der Hoforganist Schale waren zuletzt immer g egenwrtig, untersttzten mit ihrem Rate und gaben ihren Beifall durch das sichtbare Vergngen zu erkennen, welches sie hier fanden. Die schwersten Sinfonien, Konzerte und Ouvertren der Bach, Graun, Goldberg, Mthel, Benda, Hndel, Wolf, Geminiani, Vivaldi, Tartini, Hasse, Kirnberger und Quantz wu rden hier sicher und natrlich aufgefhrt. Ein Vorfall machte dem kleinen Orchester viele Freude: Ein fremder, nicht unfert iger Klavierspieler erschien und legte ein neues Konzert vom Weimarischen Wolf v or. In der Mitte des ersten Allegro hatte der Konzertist das Unglck, zwei Bltter u mzuschlagen, ohne es zu merken, denn er spielte fort. Das Orchester ward dadurch so wenig gestrt, da alle zugleich wie abgeredet den Ort trafen, wo er fortfuhr, u nd mit dem folgenden Ritornell auf den Punkt eintraten. Das Konzert war aus dem G-dur. Als das Stck geendet war, trat der Hoforganist Schale heran und sagte, die Modulation des Stcks sei ihm ganz neu; der Komponist sei mit einem Male aus dem D-dur ins e-moll geraten. Er habe dies anfnglich fr einen Schreibfehler gehalten, da aber das Orchester gefolgt sei, msse es am Stcke liegen. Hier nun ward das wahr e Verhltnis [111] der Sache aufgedeckt; wer aber von dem allen nichts glauben wol lte, war unser neuer Klavierspieler. Alle einmtigen Versicherungen der Ripieniste n, da sie beinahe eine ganze Seite htten berspringen mssen, um ihm zu folgen, waren nicht hinlnglich, ihn zu berzeugen, bis zuletzt der alte Schale an den Flgel trat u nd ihm in der eigenen Stimme des Konzertisten die zwei Folioseiten zeigte, die m an nicht gehrt hatte, weil sie nicht waren gespielt worden. Das Stck ward nun noch einmal wiederholt, wo denn alles seinen ordentlichen Gang ging. Nach Sebaldts Tode ward ich mit einem Musikus aus dem Orchester des Dbbelinischen Theaters namens Schobert bekannt. Dieser hatte eine angenehme junge Frau, welch e zu den bessern Soubretten dieses Theaters gehrte. Da beide nur eine geringe Gag e vom Theater hatten, so mute Schobert nebenher Unterricht in der Musik geben. Da durch bekam ich Gelegenheit, fter im Orchester an seiner Stelle den Dienst bei de r ersten Violine zu versehn. Ich fand mich bald so fleiig zu allen Proben ein, wu rde mit den Schauspielern und Schauspielerinnen, denen ich ihre Singrollen einle rnen half, bekannt und diesen so unentbehrlich, da ich hier ein ganz ttiges Leben fand. Manchmal stritten sich zwei, drei, ja vier dieser Leute um mich, wenn ich um neun, zehn, elf oder zwlf Uhr akkompagnieren sollte. Ich lernte hier die Arien der Hiller, Andre, Georg Benda, Schweitzer, Neefe und anderer kennen, zugleich aber auch das inwendige Leben des Schauspielergewerks, von dem ich freilich durc h Georgens Haushaltung einen kleinen Vorschmack hatte. Indessen lebte man hier mit mehr Geschmack, indem [112] man wenigstens noch einm al so viel verzehrte, als man einnahm. Was man wnschte, war vorher da; es fehlte nie an einem guten Frhstck oder sonstigen Leckereien, eher an einem Fleckchen in d er Stube, wo man es hinstellen, oder einem Stuhl, worauf man es verzehren konnte , denn alles war bedeckt und belegt mit den Werkstcken des gestrigen oder heutige
n Schauspieles. Das bunte Leben hatte sein Geflliges, obgleich ich mich dabei nic ht ganz wohl befand, weil von eigentlicher Kunst gar keine Rede war. Man fragte nur immer, wo man sich nach dem Schauspiele treffen wolle. Das bekannte Pathos d es alten Dbbelin, der seine Persnlichkeit in die Rollen und seine Rollen ins gemei ne Leben bertrug, mifiel mir deswegen nicht ganz. Ich konnte den Ernst verehren, m it dem er in Kleinigkeiten zu Werke ging. Recht schien er immer zu haben, besond ers gegen viele dieser Leute, die gar nichts wollten von ihm annehmen und sich w eit ber ihm glaubten. Das deutsche Theater hatte jedoch damals wirklich bedeutend e Subjekte. Fleck spielte als ein junger Mann schon ernsthafte, hohe und alte Ro llen mit Glck. Eine Madame Nouseul war als Lady Macbeth eine hohe Erscheinung, Ma demoiselle Dbbelin, Langerhans, Brckner und dessen Frau, eine Mademoiselle Withft, Madame Mecour, Herr Unzelmann waren in ihrer Blte; Mademoiselle Niclas war eine J ulie, wie man sie wnschen konnte; dazu kamen die Gastrollen eines Schrder, Brockma nn und anderer. Die Shakespeareschen und Lessingischen Stcke wurden mit Glck, ja mit Genu gegeben. Wre dazumal eine Seele gewesen, die den schnen Krper regiert htte, ein deutscher Frst , der das Deutsche aus Deutschheit [113] geliebt, die Dichter ermuntert, die Knst ler angefeuert, geehrt htte, die Epoche wre erwnscht genug gewesen, fr eine lange Re ihe von Jahren ergiebig zu sein, anstatt das deutsche Theater schon seit manchen Jahren wieder von den Brosamen der Franzosen leben und sich an fremden, ins Deu tsch bersetzten Sitten wo nicht bilden, doch gewhnen mu. Schobert hatte einigen Verdru beim Theater bekommen und wollte ein anderes Engage ment suchen. Dies erffnete er mir zuerst, und da er zu diesem Endzwecke verreisen mute, ersuchte er mich, an seiner Stelle zu spielen, bis er wiederkomme. Dies ta t ich sehr gern. Kurz vorher hatte ich den Anfang gemacht, seine Frau, die er Ro sa nannte, im Singen zu unterrichten. Diese Rosa war ein sehr junges, munteres W esen von gutem Hause und war mit Schobert davongegangen; ob sie frmlich verheirat et waren, wei ich nicht. Man konnte sie keine Schnheit nennen, aber sie war wohlge bildet, bewegsam und von guter Stimme, mit der sie brigens wenig anzufangen wute, weil sie nicht ordentlich gelernt hatte; indessen sang sie, wie damals mehrere i hresgleichen, frisch weg groe Arien und brachte sich, wie sie es nannte, durch. E in junger Graf von groem Vermgen hatte sich auch hier eingefunden, der eine zrtlich e Natur und nicht von der strksten Leibesbeschaffenheit war, und seit seiner Ersc heinung hatte sich das Haus sichtbar aufgenommen, weshalb ihn anfnglich selbst Sc hobert gerne zu sehn schien. Doch ward dieser jetzt eiferschtig und reisete nicht ohne Sorge weg. Er empfahl mir seine Frau, erffnete mir das Verhltnis mit dem Gra fen und bat mich sehr, seine Frau unterdessen nicht zu verlassen. Von der Zeit a n kam ich alle Tage ins [114] Haus, unterrichtete Rosa mit Eifer, und da sie mer kte, da es ihr gelang, sahe sie mich gern und machte bald Fortschritte. Als Schob ert abgereiset war, entdeckte sie mir, der Graf habe ihr einen Heiratsantrag gem acht; sie knne jedoch ihren Mann nicht verlassen, der viel um sie gelitten htte; d as Theater sei ihr auch lieb geworden, und die Familie des Grafen wrde eine solch e Verbindung doch nicht zugeben wollen. Ich wute ihr nichts anders zu raten, als da sie dies ihrem Manne schreiben solle; in jedem Falle aber solle sie fortfahren , ihr Talent zu kultivieren, sie mge sich entschlieen, wozu sie wolle. Ich wurde n un selber eiferschtig auf den Grafen und war dadurch in groer Verlegenheit. Davon zu bleiben und mit dem Grafen zu brechen war nicht ratsam, da er in diesem Hause viel aufgehen lie und ganz artige Dejeuners und Soupers gab, an welchen ich gern Anteil nahm, weil es sehr munter dabei zuging. Unter den Leuten, welche der Gra f mit in diese Partien zog, war ein junger, munterer Mann namens Daval, der mit ihm wohnte und eine Art von Aufseher zu sein schien, obgleich er es sich niemals merken lie, denn er machte alles mit und lebte mit dem Grafen in enger Freundsch aft. Eines Morgens kam der Graf zu mir und erffnete mir seine unberwindliche Neigu ng zu Rosa: er knne ohne sie nicht leben. Er she, da ich ihr Vertrauen bese, ja sie s chiene mehr als vielleicht billig sei, auf mich zu halten; ich solle ihm behilfl ich werden, es solle mein Schade nicht sein. Ich sagte ihm, er htte zu bedenken, da er mit einer verheirateten Frau in Abwesenheit ihres Mannes zu tun htte; wie ic h Schobert kenne, sei er darinne eben nicht spahaft, und die Sache sei berhaupt vo
n einer Art, da ich gestehen msse, sein Vertrauen [115] sei mir eine Last geworden , die mir bis Schoberts Zurckkunft schwer aufliegen wrde. Den folgenden Morgen kam Daval zu mir Diese Epoche nun war fr mich nicht ganz unfruchtbar. Ich las mit Begierde die Lit eratur- und Theaterzeitungen. Ich hatte mir bald im Orchester einen bestndigen Pl atz ausgemittelt, wo ich bald bei den Violinen, bald bei den Bratschen ttig sein konnte. Ich bekam Luft, eine Oper zu komponieren. Es war kein Gedicht zu bekomme n. Endlich machte ich mich an die Gellertsche Oper Das Orakel, von der ich einen g uten Teil fertig hatte, wie mir jemand sagte, ich htte keine Hoffnung, dieses ver altete Gedicht aufs Theater zu bringen; daher ich denn davon ablie. Um diese Zeit waren die Benda'schen Opern aufs Theater gekommen, an denen ich ei nen so groen Anteil nahm, da ich im Orchester mit meiner Violine in der Hand Trnen bittren Anteils vergo. Der Komponist selber (Georg Benda) erschien in Berlin und dirigierte seine Opern. Ich war sehr aufmerksam auf alle Worte und Zeichen, die der originelle Mann von sich gab, dem Orchester und den Sngern seine Meinung deut lich zu machen, und ich glaubte alles zu verstehn, da ich mit den Personen des S tcks bekannt war. Juliens Bild, wie es sich durch Bendas Musik in mir eingegraben hatte, konnte ich nun gar nicht mehr loswerden; ich lebte und litt, ich lag im Sarge mit ihr. So weit wollte ich es bringen! Die Komposition eines solchen Stcks sollte mein Ziel sein! Schon die Ouvertre erregte meine ganze Eifersucht. Der stille Anfang derselben, d as Abwechseln der Instrumente [116] im Orchester mit denen auf dem Theater, die obligaten Violinen und Flten, das stille Suseln des ganzen Orchesters, das nur von einzelnen ahnungsvollen Akzenten unterbrochen wird, erschuf mir das unvermischt e Bild einer sen, geheimnisvollen Frhlingsnacht, durchwirkt von schmetternd rhrenden Nachtigallgesngen, die sich endlich in den Schlummer der ganzen Natur verlieren. In solcher Nacht, so fhlt' ich's, kann die Liebe den Liebenden erwarten. Noch er innere ich mich der Sorgsamkeit, mit welcher ich den sanftesten Ton aus meiner V ioline zu ziehen suchte, um nur die heilige Ruhe dieser Nacht nicht zu stren, in welcher Romeo zu seiner Julie schleichen soll. In einer Probe dieser Oper, an der Stelle, wo Laura erscheint mit den Worten: Ach ! eben schlo ihr mdes Auge der schmerzenstillende Schlaf, begleitete das Orchester nicht sanft genug. Benda rief den Spielern zu: Meine Herren, Sie werden das arme Kind wieder aufwecken! Spielen Sie ja sacht! Ich hatte bisher die Violin- und Flgelkonzerte dieses Komponisten wie ein gelernt es Pensum mit Eifer gespielt, ohne da ich mir gefiel, und nahm das Herz, den gute n Benda zu bitten, sich von mir eins seiner S oli vorspielen zu lassen. Er sagte mir das gewhnliche Bravo! Nun bat ich ihn, mich nicht so abzufertigen und mir sein e Meinung offen zu sagen. Darauf versetzte er in seinem treuen bhmisch-deutschen Dialekt: Ich glaubte, Sie wollten nur gelobt sein: ich habe dies Solo fr mich und meine Hand gesetzt und es gespielt wie das meine; wenn es Ihnen also gefallen so ll, so mssen Sie es spielen, als wenn Sie es gemacht htten; sonst mag ich es auch nicht gemacht haben. [117] Nun wute ich, woran ich war, ohne mir den Sinn dieser Worte erklren zu knnen, die sich in meinem Gemte wie ein Rderwerk bewegten. Unterdessen spielte ich mehre re Wochen lang nur dies Solo und fiel endlich darauf, mir eine Stelle nach meine r Hand abzundern, wodurch ich vermgend wurde, das ganze Stck mit geflliger Bequemlic hkeit bis ans Ende zu bringen. Dadurch fing ich an, mir selber zu gefallen, und nun war ich imstande, dem Stcke einen Totalausdruck abzugewinnen, wodurch es mir immer lieber wurde. Ohngefhr acht Tage darauf wurde Bendas Ariadne im Orchester probiert, und Benda sel ber fhrte die Musik an. Ich sa an der ersten Violine neben dem Vorspieler, der mic h unterrichtet hatte. Nach der Sinfonie kehrte sich Benda zu mir, rckte meinen Ob
erleib zurecht und sagte: Wer f mssen Sie halten! sagte er prochen hatte, rckte sich das e, von der Zeit an eine Brille
nicht sehn kann, mu sich aufs Raten legen; und darau zum ersten Violinisten. Im Nu, als er diese Worte ges ganze Orchester zurecht, und mir war es eine Ursach zu tragen.
Als Benda fort war von Berlin, fing mir an, das Leben und mein Dienst bei den Sc hauspielern langweilig und heillos zu werden. Die Benda'schen Musiken hatten zug leich so auf mich gewirkt, da mir die Musiken der andern Theaterkomponisten nach und nach immer weniger schmecken wollten. Ich vermite darin jene Heiterkeit, die glhende Leidenschaft, die mich eben wie aus dem Schlummer erweckt hatte. Gar zu l ange konnte ich dies nicht verhehlen; ich lie mich darber in etwas derben Worten a us; man fing an, klter gegen mich zu werden, und kaum war Benda nicht mehr in Ber lin, so war(ich) [118] auch nicht mehr im Orchester, nachdem ich mich etwa ein v olles Jahr in diesem Wesen versucht hatte. Einer meiner heien Wnsche war indessen unerfllt geblieben. Ich kannte noch keine or dentliche Partitur und hatte schon lngst gewnscht, ein Benda'sches Stck in Partitur zu sehn, und dazu war mir nun durch die Entfernung vom Theater die Hoffnung gan z abgeschnitten. Darber fiel mir ein, da ein Bratschist aus dem Orchester, der nebenher ein Taubenhn dler war, einst gesagt hatte, er bese die Partitur von Bendas Ariadne auf Naxos. Zu diesem nun ging ich hin. Er besa die Partitur wirklich, wollte sie aber nur verka ufen und verlangte so viel Geld dafr, als ich nicht hatte. Eines Tages kam er zu mir und sahe auf meinem Hofe ein paar Tauben sitzen, welche einem Nachbar gehrten , und verlangte von mir, ihm diese Tauben zu geben, so wolle er mir die Partitur der Ariadne leihen. Daraus konnte nun freilich nichts werden, weil ich nicht einm al wute, wem die Tauben gehrten. Indessen hatte ich bald ausgemittelt, da diese Tau ben einem Sekretr gehrten, mit dem ich fter in Konzerten gewesen war. Zu diesem nun ging ich hin, und nach manchem Hin- und Herreden wurde ich mit ihm einig, da ich ihm fr diese Tauben ein neues Bratschenkonzert komponieren sollte. Darber erhielt ich meine Tauben, welche ich sogleich gegen die Partitur umtauschte, an der ich Tag und Nacht schrieb, um solche so bald als mglich zurckzugeben. Das Vergngen, welches ich beim Abschreiben dieses Werkes empfand, ist nicht auszu sprechen. Ich sah das Theater vor mir mit allem, was darauf gehrt, und nahm mir v or, ein hnliches Stck zu komponieren, worin es an Lwen und andern Ungeheuern nicht fehlen sollte. [119] Das Gedicht selbst mifiel mir brigens im hchsten Grade. Der Name Theseus war mir ehrwrdig. Diesen Theseus, den Besieger des Minotaurus, den Retter der Shne sei nes Vaterlandes, sah ich hier klagen, ohne da ihm ein Finger weh tut, wie einen b ankerotten Kaufmann davonlaufen und seine edle Retterin in der Einsamkeit unter den Tieren der Wildnis verlassen. Die Musik ri mich hin zum Anteil an etwas, und an den Personen dieses Stcks konnte ich keinen finden; Ariadne kam mir vor wie ei n deutsches Brgermdchen, in fremde Kleider versteckt. Erst schlft sie, dann schimpf t sie, und endlich stirbt sie. Theseus kommt; niemand wei woher, warum, und noch weniger wei er selber, warum er geht. Das Ganze erschien mir wie eine Reihe von A lltglichkeiten, in griechisches Gewand gehllt. Mein Anteil an Ariadnen, mein Unwil le ber den Theseus und meine Bewundrung der herrlichen Musik verwirrten mich. Was einen tiefern, obgleich weniger geflligen Eindruck machte, war die Medea des nml ichen Komponisten; ich sage: die Medea. Denn auch Jason war keinen Augenblick im stande, etwas anderes als meinen Ha zu erregen. Er erscheint weder als ein Held v on Kolchis noch als ein Mann, und Medea mute von Rechts wegen ein gemeines Weib s ein, um solch einem Kerl nachzulaufen. Doch die Musik glich alles aus. Es war na trlich, da die Empfindung, welche mir bang machte oder wohl tat wie den gegenberste henden Helden, uns beide vereinigen mute. Htte die Musik jedoch mehr Antikes gehab t, so wre der Dichter verloren gewesen, dem man um des Komponisten willen gern ve rzieh.
Ich dachte lange darber, wie man nur so etwas darstellen [120] wolle, und da mir die Reden dieser Personen ohnehin etwas journalier vorkamen, fiel (ich) auf den Gedanken, da wohl noch ein mehreres hinter dieser Fabel verborgen sei, welches au s diesem Stcke nicht hervorgeht. Ich fragte meinen Freund Moritz, und nun war's a m Tage, da dieser Dichter nur dem Komponisten hatte wollen Gelegenheit geben, uere Zustnde mit Musik zu begleiten. Daher nahm ich mir vor, wenn ich einst ein solche s Stck komponieren wrde, meinen Dichter besser zu beobachten, damit nicht das, was die Empfindung baue, durch Verwirrung der Begriffe wieder zerstrt werde. Etwas hn liches hatte ich auch an der Oper Romeo und Julie auszustellen. Das Ende des Stcks war mir vllig zuwider, ja verhat. Diese schnelle Verwandlung des tiefsten Todessch merzes in wilde, ausgelassne Freude bergehn zu sehn, war mir zerstrender als der T od selber. Dies klagte ich dem Professor Engel, der mir weiter nichts sagte, als : das ganze Gedicht sei keinen Schu Pulver wert. Nun hatte ich auch mein Bratschenkonzert fertig. Es war in neuern Zeiten der ers te eigentliche Versuch, in einem Konzerte etwas mehr als das blo Spielen, das Hren lassen zum besten zu geben. Ein pathetisches Allegro sollte eine ernsthafte Stim mung geben, darauf sollte ein tief bewegendes Adagio dieser Stimmung Unruhe und groe Arbeit schaffen, die sich zuletzt im Rondo zu freier Behaglichkeit erheben u nd das Ganze heiter abschlieen sollte. Das Konzert selber aber sollte ein Ganzes sein, und deshalb hatte ich aus dem Adagio etwas in das Rondo verwebt, das rezit ativisch vorgetragen wurde. Mein Sekretr hatte eine unendliche Freude, als er sei n Konzert zum ersten Male spielen hrte. Es wurde zweimal [121] nacheinander gespi elt, und die es hrten, bewiesen mir ihre Zufriedenheit und munterten mich auf, di esen Weg zu verfolgen und mehr dergleichen zu komponieren. Dies war jedoch nicht mein Sinn; ich dachte auf ganz andere Dinge. Bis jetzt hatte ich noch gar keinen Unterricht in der Komposition gehabt. Ich wut e nur zu gut, wie sauer mir dieses Konzert geworden war, um meine Intention dari n nur einigermaen klarzumachen. Diese Intention bestand in nichts Geringerm, als ein klassisches Werk zu liefern und mich bei Kennern geltend zu machen. Ich sa daher whrend des Komponierens berall fest, ohne die Mittel zu kennen, mir fo rtzuhelfen. Dazu, glaubte ich, msse man die Kunst im ganzen Umfange verstehen, un d nun dachte ich auf weiter nichts, als wie ich mir diesen Unterricht verschaffe n wollte. Ich hatte lngst gewnscht, eine Kirchenmusik zu komponieren. In der St. Georgenkirc he wurde an einer neuen Orgel gebaut, welche ihrer Vollendung nahe war. Ich ging zum Kantor Schmidt und trug ihm mein Verlangen vor, ihm eine Musik fr die Einwei hung seiner Orgel anzufertigen, wenn er mir einen Text geben wolle. Der etwas st eife Mann ma mich mit den Augen von unten bis oben. Er habe zwar, sagte er, noch keine Musik zu dieser Feierlichkeit, doch sei ihm eine versprochen, und einen Te xt habe er nicht. Ich merkte recht gut, da mich der gute Mann nicht fr voll ansahe; das bloe belnehmen konnte aber nicht viel helfen, weil eine so gute Gelegenheit zu einer neuen Kir chenmusik nicht gar oft eintritt. Ich nahm daher einen schon komponierten Text, n derte darin allerlei nach meinem Sinne und trug diesen Text zum Kantor mit [122] der Frage, ob ich ihm diesen komponieren solle. Er nahm ihn mir nicht ohne Grav itt ab und sagte, er wolle ihn durchlesen und mir Antwort sagen. Ich war sehr ungeduldig, keine Antwort zu erhalten; deshalb ging ich zu meinem F reunde George, erzhlte ihm mein Bedrfnis. Er lchelte und sagte: Ihr seid beide ein p aar wunderliche Leute. Er schmt sich, eine Musik umsonst anzunehmen, die er doch braucht, und Sie brennen fr Begierde, ohne Not einem Undankbaren zu dienen. Ich w erde mit ihm reden, und wenn er noch keine Musik hat, werde ich ihm sagen, da er ein Narr ist. George kam zurck, brachte mir meinen Text wieder und sagte: Mit dem M enschen ist nichts anzufangen, wie ich denn noch niemals einen Pedanten gesehn h
abe, der wte, was er will. Mein Rat ist der: Komponieren Sie Ihren Text, wenn Sie der Luft nicht widerstehn knnen, und wenn Sie fertig sind, wird sich das andere v on selber finden. Ich hatte wirklich schon den Anfang gemacht; der erste Chor und ein Rezitativ wa ren fertig. Wer hat Ihnen denn diesen Text gemacht? fragte George. Ich sagte ihm, es sei der nmliche, den der hiesige Kantor Khnau auch komponiert htte. Das mssen Sie ja nicht sagen, rief er, sonst tut's der Narr gewi nicht! Sie sind einander spinnef eind. Ich fuhr also mutig fort, aufs Ungewisse meine Musik zu machen und war bei guter Zeit damit fertig. Die Orgel war vollendet, und Schmidt hatte noch keine M usik, weswegen er denn auf Georges Versicherung, da die Musik gut sei, meine Arbe it passieren lie. George und ich hatten zur Auffhrung dieser Musik alle unsere Freunde zusammenberu fen, und ich durfte auf [123] eine Auffhrung hoffen, die meiner Arbeit vorteilhaf t war. Da die Musik zur Einweihung einer Orgel gemacht war, so hatte ich eine Ar ie mit der konzertierenden Orgel angebracht. Der Organist war ein alter, stumpfe r Mann und verbat sich diese Arie. Das war mir ein Donnerschlag, eine meiner bes ten Intentionen vernichtet zu sehn; berhaupt aber war es mir unangenehm, da dieser alte, unwissende Mann zu meiner neuen Musik die Orgel spielen sollte. Ich bat einen Freund, der ein guter Orgelspieler war, den Mann zu disponieren, i hn die Orgel spielen zu lassen, wenn meine Musik gegeben wrde. Dieser kam zurck un d brachte abschlgliche Antwort. Des Organisten Frau kam zu mir und erhub ein jmmer liches Geheul, da ihr Mann gerade am Tage der Orgeleinweihung nicht selber spiele n solle. Der Kantor sagte, er knne sich darinne nicht mischen, und ich geriet in einen hoffnungslosen Zustand. Es wurde eine Probe in der Kirche gehalten, die un glcklich ablief, denn der Organist kam gar nicht vom Flecke, und meine Musik, wor an ich so warm und fleiig gearbeitet hatte, klang ganz entsetzlich. Meine Not wuc hs mit jeder Stunde; ich schmte mich, ich weinte die Nchte hindurch, ich rgerte mic h, da alles so ruhig um mich her, jeder sein Geschft trieb. Der Organist erklrte en dlich: dies sei gar keine Kirchenmusik; er knne sich damit nicht befassen und er werde bei meiner Musik die Orgel verschlieen! Dies gab mir Mut, indem es meine En tschlossenheit erweckte. Ich lief zum Stadtprsidenten Philippi, stellte ihm mein Ungemach vor, wie ich aus gutem Herzen alles getan zum Lobe Gottes und zur Feier des Festes. Meine Rede flo mir von den Lippen; ich war aufs hchste gespannt und f orderte Gerechtigkeit. [124] Der alte, wrdige Stadtprsident griff mir freundlich ans Kinn, indem er sagte , ich solle ganz ruhig sein; die Orgel solle zu meiner Zeit mein sein und keines andern, er werde selber in der Kirche sein und meine schne Musik, wie er sie nan nte, anhren. Dies beruhigte mich, und ich ging. Zu Hause fand ich ein Billet; meine erste Snge rin war krank geworden. Ich lief zu ihr und berzeugte mich. Es war im Monate Nove mber, seit vierzehn Tagen hatte es immerwhrend geregnet; der Kot auf den Straen wa r ermdend. Den ganzen Tag ward ich erhitzt und durchnt, die Nchte ohne Schlaf gewese n; ich sprte ein Fieber, und nun konnte gar das Unglck kommen, da ich am Tage meine r Musik im Bette sein mute. Die Angst meines Herzens war grlich. Ich witterte eine Sngerin aus, doch diese verstand so wenig Musik, da ich keine Hoffnung vor mir sah e, ihren Vortrag nur einigermaen mit Zufriedenheit gekrnt zu sehn. Die Generalprobe kam heran. Sie ward in der Kirche gehalten. Es regnete den ganz en Tag. Der schnden Witterung wegen kamen viele Musiker nicht in die Probe; aber meine kranke Sngerin erschien und sagte, sie habe von meinem Unglcke gehrt und woll e singen, so gut sie knne. Ich mute nun die Orgel selber spielen, da jeder andere durch die Weigerung des Or ganisten war verscheucht worden. Die Probe ging so gut als sie konnte, denn Geor ge, der den Kontraviolon spielte, nahm sich der Musik hilfreich an. Er bat die H
erren fter, zu wiederholen, und fr heute ging die Sache gut genug, indem er mir di e Versicherung gab, morgen wrde alles da sein und jeder wrde das Seinige gern tun. Alles das [125] war nun auf den Kantor Schmidt auch nicht ganz ohne Wirkung gew esen. Er hatte meine Angst gesehn, meine Sorge und Bemhung mit zu groer Gelassenhe it ertragen; das fhlte er wohl. Er fragte mich, wieviel Texte er wohl sollte druc ken lassen. Ich riet ihm zu dreitausend Stck. Gott behte!, schrie er, wo denken Sie h in! Dreihundert wird zuviel sein! Ich kann das Stck nicht unter einen Groschen ve rkaufen, weil der Text einen ganzen Bogen betrgt, und ich leide den grten Schaden! Denn was brig bleibt, wird Makulatur! Ich kann die Musik ja niemals wieder auffhre n! Es war das erste Mal, da ich diesen Mann in voller Lebhaftigkeit seines ganzen We sens wie eine Flamme aufschlagen sah. Ich sagte ihm: Tun Sie, was Sie wollen, aber ich halte es fr besser, da Ihnen einig e Texte liegen bleiben, als da Ihnen welche fehlen. Endlich sprach ich mit seiner Frau, mit der ich denn handelte und sie von Hundert zu Hundert hinaufstimmte, un d es wurde beschlossen, achtzehnhundert Stck druckenzu lassen, denn bis auf zweit ausend konnte ich sie nicht bringen. Bis jetzt war ich in einer bestndigen Fieberbewegung gewesen. Nach der Generalpro be war ich mit eins ruhig geworden. Ich bekam Hunger und a mit Begierde. Die Nach t hindurch schlief ich mit Ungestm, und der Morgen fand mich gerstet. Mein erster Gang war zum Kantor, der mir nicht ohne Hastigkeit sagte, er habe noch keinen ei nzigen Text verkauft. Ich stand an der Kirchtre und sahe die Leute hineinstrmen und zu meiner groen Freud e viele alte Musiker, und endlich den alten Marpurg, der mich sehr munter und fr eundlich grte. Als ich diesen gesehn hatte, ging [126] ich an mein Amt, verteilte die Stimmen und sahe, wie meine Freunde, die Musiker, nach und nach sich ansamme lten und mich grten. Die Trompeter und der Pauker waren die Devotesten, und so gin gs nach und nach etwas klter hinauf bis zu den ersten Violinisten und Sngern, in d eren Hnden das Schicksal eines angehenden Komponisten liegt. Meine Musik begann. Noch tnen die herrlichen Trompeten in meinen Ohren. Alles lset e sich zu mei ner Zufriedenheit auf, indem alles von mir abging, ja abfiel wie e ine leichte Decke. Besonders gefiel meine Orgelarie, welche mir doppeltes Vergnge n brachte, weil ich sie selber spielte. Nach der Musik ward ich von allen Musike rn aufs freundschaftlichste angesehn. George umarmte mich krftig und gerhrt. Seine Gehilfen und Lehrlinge sahen in einiger Entfernung meiner Erhebung zu; ich war glcklich. Nach der Musik ward ich von der Kantorin frmlich zu Tische gebeten. Bei Tische ward von mir gesprochen, und der Kantor legte etwas von seiner Wrde beisei te, indem er sagte, er wnsche, da er mir gefolgt sei. Er habe alle seine Texte ver kauft, und nun, nach der Musik, schickten die Leute noch immer nach Texten. [Ja, er wrde ber viertausend verkauft haben, wenn er sie gehabt htte.] Ich war ber allen Ausdruck glcklich und ward es immer mehr. Am andern Morgen erhie lt ich ein Schreiben mit fingerlangen Buchstaben von Herrn Marpurg, worin er mic h aufs freundschaftlichste anzufeuern suchte, die Ordnung meiner Komposition lob te, und dergleichen. Das Sonderbarste bei dieser Geschichte bestand darinne, da mein Vater von allen d iesen Dingen nichts [127] wute oder nichts zu wissen scheinen wollte, da so viele Leute davon wuten. Um diese Zeit wurde mein erster Versuch in Klavierstcken bei Rellstab gedruckt un d in der Zeitung angekndigt. In einer Gesellschaft, von der mein Vater Mitglied w ar, ward die Zeitung vorgelesen und also auch diese Ankndigung. Mein Vater sagte, es sei das erste Mal, da ihm sein Name auf diese Art vorkomme, und er habe nicht gewut, da auer ihm und seinem Sohne noch jemand in Berlin diesen Namen fhre. Der al
te Schmeling (Vater der berhmten Mara) war zugegen und sagte: Das ist ja auch Ihr Sohn und kein anderer! Doch mein Vater glaubte dies nicht eher, bis er mich selbe r gefragt hatte, wer mich so viel Musik gelehrt htte. Ich sagte, da ich ohne Lehre r gelernt htte, doch gerne weiter fort wollte, denn ohne eine ordentliche Schule sei doch nichts Rechts zu leisten, man msse so viel versuchen, und darber verginge so viel Zeit. Musik, meinte mein Vater, wte ich nun genug, und fragte, ob ich Ita lienisch lernen wolle; der Professor Sanseverino habe seinen Unterricht angebote n. Ich war voller Freude, und das Italienische ward angefangen, doch sollte ich nur drei Monate lernen, denn der Professor htte gesagt, in drei Monaten knnte ich so weit sein, mir selber fortzuhelfen. Dieser Sanseverino (Verfasser der Vita di Bianca Capello) war Dichter; das war mir lieb. In der ersten Stunde konnte ich lesen und mit Hilfe des Lateinischen auch manches verstehen. Der Poet verfertigte mir eine Kantate La Medea, die ich soglei ch in Musik setzte. Von ihm erhielt ich auch die Partitur von Schwanenbergers Rom eo e Giulia, welche ich abschrieb, und nun [128] war ich wieder eine Zeitlang seh r glcklich und dachte hufig nach Italien. Ich fate nun den Entschlu, den ordentlichen Kursus der Harmonie bei Fasch zu lerne n. Dieser aber war so besetzt, da er keine Lektion annehmen konnte. Einer von Fas chens Schlern, den ich kannte, sagte mir, er hre auf, Lektionen zu nehmen, und wen n ich noch gesonnen sei, Unterricht zu nehmen, so wolle er mich vorschlagen. Ich war bereit. Fasch verlangte erst etwas zu sehn von meiner Arbeit, und so ging i ch hin und zeigte eine Sinfonie und eine Sonate vor, welche Fasch durchsahe. Ich ward angenommen, und nun ging ich zu Fasch in die Lehre. Als ich hier angefa ngen hatte, schickte Kirnberger zu mir und lie mich rufen. Ich kam. Er kannte mic h schon, wie ich ihn. Sie haben ja, sagte er, eine Kirchenmusik gemacht, die ich so rhmen hre. Lassen Sie mich doch diese sehn! Wo haben Sie denn gelernt? Ich antwort ete, ich habe nirgends und so viel als nichts gelernt; erst seit kurzem sei Herr Fasch so gtig, mich durch seinen Unterricht zu beglcken. Nun, sagte er, wenn Sie das lernen, was er kann, haben Sie alle Hnde voll. [Den Kontrapunkt versteht er orde ntlich, seine Kanons sind gewi gut, und dabei hat er einen guten, ja einen seinen Geschmack. Sebastians Sachen habe ich von keinem besser spielen hren, und des Ha mburgers Sachen spielt er noch besser. Was mir nicht an ihm gefllt, ist, da er all en alles recht machen will.] Ich glaubte, meine Sache sehr gut zu machen und erzhlte Faschen, da mich Kirnberge r rufen lassen, und was er mir alles zu seinem Lobe gesagt htte. Fasch hrte mich r uhig an, bis ich fertig war. Nachdem die Lektion geendigt war, sagte er, er msse gestehen, da [129] seine vielen Lektionen ihm anfingen, beschwerlich zu werden fr die wenigen heitern Stunden, welche ihm seine Krnklichkeit brig lasse; und obgleic h er gern und mit Genu unterrichte, so msse er doch anfangen nachzulassen, denn es sei doch fast zuviel, vom frhen Morgen an und auch nach Tische immerfort zu unte rrichten. Dagegen habe Kirnberger gar nichts zu tun und leide einigermaen Not. Ich solle da her Faschen die Liebe erzeigen, ihn von meinem Unterricht zu dispensieren; er knn e mir dagegen Kirnbergern als einen vollkommen grndlichen Harmonisten anrhmen, der sich zugleich freuen wrde, einen geistvollen Schler in mir zu finden. Mich traf diese Rede wie ein Blitz; ich konnte vor Wehmut nicht gleich antworten und stand traurig da; es war, als wenn ich mein Todesurteil aussprechen hrte. Als ich die Sprache wiederbekommen hatte, sagte ich, da ich ja nur eine einzige S tunde wchentlich bekme, wenn er in Berlin sei, und da er sechs Monate des Jahres i n Potsdam lebte, so erhielte ich ja im ganzen Jahre kaum ein viertelhundert Lekt ionen. Ich htte jahrelang auf seinen Unterricht gewartet und mich darauf gefreut; woher es denn komme, da von allen seinen Schlern er mich auswhle, mich allein vers toen wolle? Ich liebte ihn; ich hinge an ihm und seiner Lehre mit ganzer Seele. O
b er denn von diesem allen nichts fhle? Ich kann Ihnen aber nicht ntzlich genug sei n, doch wenn Ihnen die wenigen Lektionen hinreichen, so bleiben Sie in Gottes Na men; an fnfundzwanzig Lektionen mehr im Jahre werde ich nicht sterben, doch Sie w erden davon auch keinen rechten Vorteil haben, denn Sie sind alt genug, keine Ze it mehr verlieren zu knnen. Herr [130] Kirnberger ist bestndig in Berlin, Sie knnen daher bestndig von ihm lernen. Wollen Sie indessen bei mir bleiben, verstoen will ich Sie nicht! Ich war sehr niedergeschlagen, indem ich glaubte, Fasch habe etwas gegen meine K onduite, in welchem Punkte ich nicht sein aufmerksamster Schler sein mochte. Inde ssen konnte ich hinwiederum bemerken, da er mit meiner Intelligenz nicht unzufrie den war, besonders da ich zu seinen einzeln vorgetragenen Lehren immer sogleich mit einer Anzahl Beispiele bereit war, worauf sich jede Lehre anwesenden lie. Ich wute nun nicht, ob ich zu Kirnbergern wieder hingehn und diesem meine Kirchen musik bringen sollte, da sie Fasch noch nicht einmal gesehn hatte. Endlich sagte ich mir: Kirnberger hat deine Musik verlangt; verlangt die Fasch auch, so kann auch er sie haben. So trug ich meine Musik zu Kirnbergern. Er las erst den Text, welchen er kannte. Als er das Ganze durchgegangen war, sagte er: Ei nun, das mag wohl recht stark k lingen! Ich bat ihn, mir seine Meinung nicht zu verhehlen; ich sei berzeugt, noch weit zurck zu sein, doch voll des besten Willens, emporzukommen, und was er mir s agen werde, solle mir ein Evangelium sein; ich wolle gern auf den Grund; die Wah rheit ginge mir ber alles. Wahrheit! sagte er. Das schwere Wort reden Sie so hin, [a ls ob Sie lngst wten, wer Wahrheit ist]. Freilich wissen Sie alles: was Sie gern hre n, ist Ihnen auch Wahrheit; man darf Ihnen nur schmeicheln, und man kann Ihnen w eismachen, was man will, und dann gehn Sie von Haus zu Haus und erzhlen, was Kirn berger gesagt hat.
Ihre Musik, junger Herr, mu wohl klingen; ja schallen, [131] knallen mu sie; aber wenn ich nun hinzusetze, da sie nicht singt, nicht andchtig, heilig, kirchlich, da gegen aber weltlich, leidenschaftlich und frech ist, ist das auch wahr? Sprechen Sie! Wenn Sie es sagen, Herr Kirnberger, ist es gewi wahr! Sie haben also, fuhr er rt, das Beste ausgelassen. So gut macht es jeder Anfnger, und so hrt jeder Pfuscher auf; denn was fr Kunst kann darin sein, im Schwei des Angesichts Noten aufeinande r zu passen, bis sie harmonieren? Und wenn Sie nichts Besseres werden wollen, al s ein solcher Hucker und Drucker, so bleiben Sie bei der Kelle! Der Schmerz, den ich bei dieser harten Rede empfand, war so berwltigend, da es Kirn berger merkte und sagte: Dies scheint Ihnen weh zu tun, und Sie nehmen es gewi bel; das mgen Sie nur tun, und wenn Sie deswegen von Ihrer Komponiererei ablassen, so habe ich gewi zu Ihrem Heile beigetragen. Es gibt nichts Erbarmungsvolleres als einen gemeinen Knstler, deren so viele sind; dagegen ein gemeiner Handwerker imme r eine wrdige Person bleibt, sobald es ihm bei geringen Fhigkeiten nur Ernst ist. Was mte ich denn aber tun, sagte ich, da ich doch einmal den Trieb habe und die Lust, etwas Musikalisches zu leisten? So sprechen alle, antwortete er. Noch habe ich kein en gesehn, der nicht seine ersten Aufwallungen fr Beruf, ja fr Genie gehalten htte. Es hat sich mit dem Genie! Genie ist etwas anderes, als Ihr jungen Herren glaub t. Da luft eine Herde von Genies herum, die das Brot nicht wert sind, was sie ess en. Glauben Sie mir, junger Freund, die Natur ist nur auf die Natur eingerichtet . Was nicht in ihr gehrt, [132] kann sie nicht ernhren. Was ist denn also ein Musi kus ohne Naturell, ein Snger ohne Stimme? Und deren ist die Welt voll. Erst fange n sie an, Liedchen, Sonatchen, Sinfoniechen, Kantatchen, alles so niedlich, arti g anzufertigen, da ihren Eltern oder ihren Mdchen das Wasser im Munde zusammenluft, und nun denken sie, sie htten's, und des Genies ist kein Ende, bis man zuletzt e in Mann und ein Vater und ein Stmper ist. Soll man nun einem Menschen raten, ein Knstler zu werden? Die Musik ist die gefhrlichste von allen Knsten fr den Knstler. Da s Beste, was er leisten kann, kommt so leicht und harmlos hervor, da jeder es fr s
ein eigen hlt, und keinem dabei der himmlische Geist einfllt und die unsgliche Mhe, den Ton sicher zu finden, der in eines Menschen Herz dringt. Die Welt nimmt es h in wie die Bltter und Frchte des Baumes, wie das Licht des Tages, weil sich das vo n selber versteht; und wer wird seinem Gotte fr solche gemeinen Dinge danken? Da will man denn Auerordentliches leisten, es soll Auffallendes sein. Da mssen denn d ie Trompeten heran, und des Gepaukes ist kein Ende. So, mein junger as sei ganz was zen lernen? Sie keinen gesehn, n Hals. Freund, ist es mit dieser Musik, und Papa und Mama denken gewi, d Erstaunliches. Aber haben Sie schon einen Choral vierstimmig set fangen an bei den Zwecken; womit wollen Sie enden? Ich habe noch der glcklich um die Schule herumgekommen ist; sie brechen alle de
Sie wollen ein Handwerk treiben und eine Kunst auch; wissen Sie, was das heit? Ic h habe mein Lebelang nichts als Musik gemacht und glaube, was zu knnen, und habe mein Leben lang gepfuscht; denn wenn ich [133] groe Meister betrachte, komme ich mir vor wie ein verlorner Mensch; ich wei mich vor Traurigkeit nicht zu lassen. S ie wollen Huser bauen und nebenher komponieren, oder wollen Sie komponieren und n ebenher Huser bauen? Dies Gesprch wirkte zerschmetternd. Ich fing an, wirklich an meinem Talente zu zw eifeln, besonders deswegen, weil Fasch gar zu wenig Wesen aus mir zu machen schi en, der mir so mir nichts, dir nichts den Unterricht aufsagen konnte. Wenn ich a n die Musik dachte, schlug mir das Herz vor Angst und Sorge. Meine Kirchenmusik war mir zum Ekel geworden, und ich fand in allen Winkeln Fehler, die ich mir nic ht erklrenkonnte. Klagen konnte ich keinem, die meisten meiner Bekannten waren ka lt; ich hatte sie fr neidisch gehalten und ich wrde vor Scham gestorben sein, wenn mein Vater oder einer von ihnen Kirnbergers Sermon gewut htte. So setzte ich mich an mein Klavier und hauchte meine Leiden in wehmtigen Phantasien aus. Es war das Frhjahr 1783. An einem Sonntage nach dem Mittagsmahle beschenkte mich mein Vater mit einem neuen, sehr sauber gearbeiteten Zollstocke. Dabei zeigte er mir an, da ich dem Ende meiner Minderjhrigkeit nahe sei; morgen frh sollte ich vor das Gewerk treten und mein Vorhaben anzeigen, Maurermeister zu werden. Auf einer Seite ward ich durch diesen Befehl erschreckt, und auf der andern Seit e konnte ich kaum das Lachen verbeien ber das Vertrauen, welches mein Vater in mei ne Fhigkeit setzte. Ich erwiderte, da ich den redlichen Willen htte, ihm wie immer zu gehorchen; er we rde aber wissen, da ich in der brgerlichen Baukunst nur ein Anfnger sei und [134] ichts weiter getan als Zeichnungen kopiert htte; dagegen htte ich mich seit zwei J ahren mit Mechanik und Hydraulik beschftigt. Noch mehr aber, unterbrach er mich nell, mit Musik. Und was soll Dir das, wenn Du kannst, was Du nicht brauchst, und entbehrst, was Du wissen sollst? Ich bat ihn, die Sache so lange beruhen zu lass en, bis ich beim Oberbaudepartement mein Examen bestanden htte, welches in wenige n Monaten vor sich gehn knne; das Meisterwerden sei mir ja gewi genug. Und eben wegen, versetzte er, mu man das Gewisse zuerst nehmen, denn nur, was man hat, ist ewi; wenn Du examiniert bist, hast Du nichts und die Herrn Examinatoren auch nich t viel; denn so viel als sie Dich fragen, werden sie wohl wissen. Dagegen Du auf Dein Meisterstck wirst Meister werden und Dein Brot erwerben knnen. Wenn Du Meist er bist, bist Du Dein, dann tue, was Du weit; bis dahin tue, was ich befehle. n sch
des g
Ich bin aber darin wirklich nicht so weit, sagte ich, ich werde mich prostituieren. ein! sagte mein Vater, Du wirst Deine Schuldigkeit tun, und es wird gelingen, und ich will es! Ich versetzte: Nach dem Begriffe, der mir von der Meisterschaft beiwohne, sei ic h zu weit zurck; die Forderungen seien streng und wrde ja darinne nichts nachgelas sen, und es sei ganz unmglich, ein Meisterstck zu machen, wenn man kaum ein guter
Schler sei; er solle mir doch nur vorher ein Jahr bung verstatten. Wunderlicher Men sch! rief er aus, was willst Du denn beginnen, solange Du nicht auf Deinen eigenen Fen stehst? Das Meisterstck soll eben die bung sein, der Anfang in Meisterstcken; un d dazu mut Du erst [135] Meister sein, weil Du nicht eher Gelegenheit dazu hast; ja hier gehn erst die eigentlichen Lehrjahre an: die Verlegenheit, die Not, der Verdru, das sind die wahren Lehrmeister! Ich werde mich wohl hten, Dich fr mehr zu halten, als Du bist; doch was hier gefordert wird, wirst Du, mut Du knnen! Ob nun gleich mir dies alles nicht ganz klar vorkam, so mute ich nachgeben, denn mein Vater fing an, warm zu werden. Wie ich mir die Sache einsam berdachte, fielen mir allerlei Dinge ein, von denen die Musik nicht das letzte war. Kirnbergers frchterliche Ermahnung regte mir den tiefsten Grund auf. Was konnte er davon haben, mich von der Musik abzuraten? Er, der in Wahrheit hilfreich gegen angehende Musiker war und, wie ich wute, mehrern den Unterricht unentgeltlich gab? Es schien mir daher ausgemacht, da ich zur Mus ik schon zu alt (sei) und kein entschiedenes Talent besitze. Daher entschlo ich m ich nun einmal wieder, mich mit aller Gewalt ins Handwerk zu werfen. Am folgenden Morgen erschien ich vor dem Gewerk. Ich kann nicht sagen, da ich dab ei unruhig oder furchtsam gewesen wre, und fast war mir's, als wenn sich der Wuns ch in mir regte, da ich mchte abgewiesen werden, weil ich als Gesell wenig gemauer t hatte; doch ich ward angenommen. Mein Vater war zu der Zeit Oberltester. Seine smtlichen Freunde ermunterten mich, meinem sehr geschickten Vater nachzuschlagen, lobten meinen Vorsatz, und es ward mir aufgegeben, vorher ein Haus zu bauen, woran ich als Polier[er] arbeiten sol lte. Mein Vater hatte bereits einen solchen Bau, und ich [136] trat mein Amt als Poli er[er] sogleich an. Das Haus war angelegt, und ich sahe nicht ohne Zufriedenheit das Fundament unter meinen Hnden aus der Erde hervorgehn, denn ich hatte dazu ei ne hinlngliche Anzahl guter Leute, die mit mir zufrieden waren wie ich mit ihnen. Seit dem vorigen Winter war ich in einem damals angesehenen [jdischen] Hause beka nnt, wo zwei erwachsene Tchter waren. Die jngere, welche man Janny nannte, zeichne te und malte in l. Sie war achtzehn Jahre alt, von gedrungenem Wuchse, hatte die Farbe ihrer Nation, eine etwas gebogne Nase und einen unvergleichlich schnen Mund ; die Augen, Zhne, Arme und Busen waren das Prchtigste, was man sehn kann. Die lteste Schwester Adele war schner von Farbe und Gestalt, von seiner weier Haut, blauen Augen und sehr einnehmendem Wesen; dabei hatte sie eine rhrende und weich e Sopranstimme und sang Stcke, die ihr gefielen, vortrefflich. Sie hatte einen Si ngmeister, doch unterrichtete auch ich sie in solchen Stcken, die ich ihr mitbrac hte, und mein Unterricht schien ihr annehmlich, indem sie bald bedeutende Fortsc hritte machte. Das Familienverhltnis dieses Hauses zog mich eben nicht an. Die Mutter trieb ihr Wesen fr sich und der Vater desgleichen auf seine Art. Aber der letztere, welcher fr einen schnen Geist gelten wollte und auch ein Drama geschrieben hatte, fand se ine Freude darinne, Gelehrte, Dichter und Knstler nicht selten in seinem Hause zu sehen. Dies war nun mir sehr willkommen, und ich sahe hier zuerst Moses Mendelssohn, Ra mler, Engel, Leuchsenring, Stamford, Rode, Chodowiecki, Meil, Brandes und andere , und erfreute mich im stillen an den Reden dieser [137] Mnner. Willkommener noch waren mir die beiden sehr ausgebildeten Mdchen, die ich alle Tage sehn durfte, d a sowohl die Mutter wie der Vater jeder gleichsam fr sich lebte, und die Tchter de sgleichen. Janny sowohl als Adele sprachen und schrieben vollkommen Franzsisch un d waren der englischen und italienischen Sprache mchtig. Mit ihnen konnte ich ung
estrt stundenlang von Kunst reden. Es ward gesungen und gespielt, und Janny malte und teilte ihre Bemerkungen mit. Es whrete nicht gar lange, als sich zwischen de r letztern und mir ein leidenschaftliches Verhltnis entspann. Wir sahen uns tglich , doch wurden nebenher lange Briefe gewechselt, in welchen sich bald meine Sehns ucht nach Italien verriet und wovon endlich auch Janny angesteckt ward. Auch sie wollte ihre Kunst auf klassischem Boden gedeihen sehn und ihrem Vorbilde, der b erhmten Angelika, nher sein. Mir selber schien dieses einmal wieder eine Weisung meines guten Genius, und wen n diese mich nicht nach Italien fhrte, so sagte ich mir sei auch alles an mir ver loren. Ich beschftigte mich nun mit Planen unserer Reise, die mir jedoch weit meh r Mhe machten als das vorige Mal, indem sich meine Lage um vieles verndert hatte, und Janny, mit der ich ber viele Dinge in Streit geriet, manches auf ihre eigene Art veranstaltet wissen wollte. In jedem Falle mute ich nun erst Meister sein, un d dazu brauchte ich wenigstens ein Jahr Zeit.
Zufllig sprach ich einen von Kirnbergers Schlern, der in meiner Kirchenmusik mitge sungen hatte. Er lobte meine Musik und sagte mir, Kirnberger halte etwas auf mic h. Ich konnte meine Verwundrung nicht verbergen und setzte ihm entgegen, da ich d ies besser wte. Wie? sagte er, Sie haben ihm ja Ihre Musik selber [138] gebracht, und er hat mir davon gesagt, da er bei einem so jungen Menschen weder den Ernst noch die Khnheit gesucht htte. Hat er Ihnen dies wirklich gesagt? fragte ich. Er wiederh lte mir diese Worte mit allen Umstnden, und nun erzhlte ich ihm treu, wie mir Kirn berger alles Komponieren auf Lebenszeit verleidet htte; seit der Zeit htte ich kei ne Luft, eine Note zu schreiben. Das ist, versetzte er, nichts Ungewhnliches bei ihm ; je besser man es ihm macht, je unleidlicher wird er; und eigentlich lobt er nu r die, von denen er nichts hofft, bekmmert sich wenig um sie und sagt dann, sie ht ten's schn gemacht. Diese Rede gab mir meine ganze Lebenskraft wieder, und ehe ich mir's versahe, ha tte ich fr Adele, die ich sehr eifrig unterrichtete, welches von dem Vater wohlge fllig bemerkt wurde, allerlei Kleinigkeiten komponiert, die gut aufgenommen wurde n. Da ich jedoch an dem Polier[er]stcke tglich dreizehn Stunden gegenwrtig sein mute , und nach Feierabend bis Mitternacht bei Janny war, so konnte aus dem Komponier en nicht gar viel werden und aus dem Schlafen fast noch weniger. Es lag mir schw er auf dem Herzen, da ich in der Komposition, was man die Schule nennt, nicht gen ug vorwrts ging. Im Satze selbst war ich bei weitem nicht sicher; es kamen Flle ge nug vor, wo ich mir nicht selber helfen konnte, und in den Kontrapunkten war noc h soviel als garnichts geschehen. Fasch gab mir wchentlich nur eine Lektion, und wenn er in Potsdam war, erhielt ich vier Wochen lang gar keine. Es fiel mir wohl ein, Kirnbergern zu fragen; doch das konnten beide belnehmen, und ich war hier i n Verlegenheit. Der Herbst war da; mein Haus war fertig, und von[139] hier war ich nun erlst. Als ich jedoch nun meine Hnde betrachtete, das war ein trauriger Anblick! Die uere Hau t fiel fast herunter, und die Form derselben war so entstellt, da ich lange Zeit Tag und Nacht Handschuhe und erweichende Mittel brauchte, sie wieder in gute For m zu bringen. Nun erst wurde mir das Meisterstck selbst aufgegeben. Es bestand zuerst in einer Figur von sechshundertundacht Fu lang und ber siebenhundert Fu tief, dessen vordere Seite mit drei Vorsprngen versehn war; hinten aber und auf beiden Seiten hatte d ie Figur lauter Ecken und Winkel. In den Grenzen dieser Figur sollte ein Grundri zur Bewohnung zweier frstlicher Fam ilien angelegt werden. Die Familien sollten gnzlich abgesondert, zugleich aber au ch gemeinschaftlich dieses Schlo bewohnen knnen. Das Gebude sollte nach korinthisch er Ordnung drei Geschosse hoch eingerichtet, alle Grenzen auf den Seiten fest zu gebauet, und von der nachbarlichen Seite kein Licht genommen werden. Zu diesem P lane sollten nun vier Grundrisse der smtlichen Geschosse, die Fassade, ein Profil
, die Schablonen der bedeutendsten Gesimse, und zuletzt ein Kostenanschlag angef ertiget werden. Diese Figur ward mir vor dem versammelten Gewerke zur Ansicht berreicht und dann sowie das Papier, worauf alles gezeichnet werden sollte, versiegelt. Nun gab mei n Vater der Meisterschaft ein gutes Gastmahl, wobei es nicht an Munterkeit fehlt e. Da mein Vater Oberltester war, so durfte ich [doch] in seinem Hause nicht zeichne n, und ich ward daher in das Haus des Nebenltesten gewiesen, der mir ganz hold wa r, weil ich ihm nebenher seine Zeichnungen und Anschlge besorgte. [140] Am folgenden Tage ging meine Arbeit an. Ich fand dort zwei Meister, welche mir die Siegel lseten und meine Gesellschaft blieben. Die Figur hatte dem ersten Anblicke nach ein sonderbares Ansehn, denn alles dara n war mit Flei verschoben und verwoben. Die Mae der uern Linien und unzhliger Sperrli nien waren mit Zahlen in die Figur geschrieben; und manche Linie, welche mit der Zahl 50 beschrieben war, dreimal so gro als eine andere, welche mit 150 bezeichn et war; aus spitzigen Winkeln muten stumpfe, wie aus Ecken Winkel werden. Da ich nicht unerfahren in der Trigonometrie war, so bemerkte ich dies augenblicklich, und in einer Stunde stand meine Figur ganz regelmig auf meinem Papiere, wobei ich denn von meinen Gesellschaftern sorgfltig war beobachtet worden. Als die Herren d ies bemerkt und gefrhstckt hatten, zogen sie von dannen und berlieen mich meinen Ged anken. Eine so kindische Versuchung hatte ich nicht erwartet, aber es war hergeb racht und ein alter Gebrauch, dessen Nutzen ich nachher denn wohl einsahe. Da ich verschiedene italienische und deutsche Prachtgebude von Zeit zu Zeit kopie rt hatte und bald inne wurde, da hier von keinen Hexereien die Rede war, so wuchs mein Mut und meine Luft von Tag zu Tage. Meine wachthabenden Gesellschafter kam en anfangs tglich zweimal, meine Zeichnung zu ffnen und wieder zu versiegeln. Nach acht Tagen war der Grundri des Hauptgeschosses in Ordnung, und nun kam man immer seltener und bald darauf gar nicht mehr. Dies war mir nicht einmal lieb, denn h atte ich Gesellschaft, so rckte ich weiter vor, dahingegen ich nun, den ganzen Ta g allein, [141] mir Noten mitbrachte, die ich abschrieb, oder etwas Neues kompon ierte. Mein Vater hatte mir angeboten, ich solle mir die Figur zu Hause auch auftragen, damit er mich mit Rate untersttzen knne, weil er mich dort nicht besuchen drfte. D ies versprach ich, verschob es von einer Zeit bis zur andern, wie meine Zeichnun g anwuchs, und endlich war es zu spt. In fnf bis sechs Wochen war ich fertig. Mein Vater hatte eine sichtbare Freude, die saubere Zeichnung zum ersten Male zu seh n, und als ich sie dem Gewerke zur Beurteilung vorlegte, gab er ein kostbares Ga stmahl. Er hatte mich weder so fertig im Zeichnen noch in der Distribution gehal ten und war an dem Tage ganz ungemein vergngt, obwohl er nicht einmal wute, da ich whrend dieser Zeit ein ganzes Oratorium von Hasse abgeschrieben und eine Kantate komponiert hatte, meinen ununterbrochenen Briefwechsel mit Janny, die ich alle T age sprechen konnte und dennoch tglich an sie schrieb, ungerechnet. Von dem Knigli chen Hof- und Schlobaumeister Naumann, dem das Gewerk die Meisterzeichnungen zur offiziellen Beurteilung vorlegen mute, erhielt ich ein [hchst schmeichelhaftes] Ze ugnis ber die gute Anlage und saubere Arbeit, und meine Freude htte grenzenlos sei n mssen, wenn mir nicht das vermaledeite Mauern wieder bevorstand, denn nun mute i ch noch ein Haus in Natura bauen, an dem ein Eckpfeiler, ein Rauchfang, ein Kuss en und ein Kreuzgewlbe von meinen Hnden gemauert werden sollten; wenn ich daran da chte, so war mir's, als wenn ich sollte mit Ruten gepeitscht werden. Ein solches Haus war dieses Haus rtig und Meister undzwanzig Jahre war nun bereits vorhanden, dafr hatte mein Vater gesorgt; leider so[142] gro, da ich keine Hoffnung sahe, in diesem Jahre damit fe zu werden. Meine Ungeduld war berschwenglich; ich war beinahe fnf alt, und alle meine Gedanken waren wieder nach Italien gerichte
t. Der Bankier Itzig lie dieses Haus auf seiner Meierei vor dem Schlesischen Tore aufbauen. Es sollte hundertunddreiig Fu lang, fnfundvierzig Fu tief, drei Geschosse hoch und durchaus massiv gebauet werden. Es war schon im Monate Junio, und ein kleineres Haus war fr dieses Jahr nicht mehr zu bauen vorrtig. Ich legte mein Haus an; mein Vater untersttzte mich gewaltig, indem ich tglich fnfz ig bis sechzig Leute unter mir hatte und alles fordern durfte, was ich fr notwend ig hielt. Wenn ich hier die Not und Widerwrtigkeiten betrachtete, womit ich meine erste Kir chenmusik aufgefhrt hatte, wobei mir jedes neue Hindernis ein neuer Sporn gewesen war, ohne Hilfe, als die ich mir selber gab, so konnte ich kaum aus mir selber klar werden, mit welcher tiefen Trauer und undankbaren Klte mich nun alle diese H ilfe in manchen Stunden erfllte, indem mir dies alles vergeblich und unangewandt schien, das unmglich zu etwas Gutem fhren knne. Meinen Vater, der jetzt immer freundlicher gegen mich wurde, liebte ich mit bersc hwenglicher Kindlichkeit; meine Trnen flossen, wenn ich an seine Zuneigung und Au fmerksamkeit dachte; er hoffte, sich durch diese letzte Anstrengung aller seiner Krfte in mir eine Hilfe seines herannahenden Alters und Fortpflanzung seines gut en Namens zu erbauen. Mein Gemt war aber von entgegengesetzten Trieben hin und her gerissen. Unzerstrbar war jedoch die Gesundheit [143] meines Leibs und der Seele. Ich strzte mich in d ie Arbeit aus Pflicht, aus kindlicher Treue; ich wute selbst nicht zu sagen, waru m. Da der Bau von meiner Wohnung ber eine halbe Meile entfernt lag, so mietete ic h mich dort auer dem Tore ein, um den weiten Weg zu gewinnen. Doch was half das a lles mir? Nach Feierabend ging ich zu Jeanetten, die bei ihren Eltern an dem ent gegengesetzten Ende der Stadt den Sommer ber in einem G arten wohnte. Und seit vi er oder fnf Monaten ging ich, wenn Fasch in Potsdam den Dienst hatte, jeden Freit ag nach Potsdam und nahm meine Lektion dort, von dannen ich jedesmal an demselbe n Tage wieder zurcke kam. Fasch, der von meinem jetzigen Berufe nichts wute, glaub te, da ich in Potsdam Geschfte besorgte, weil ich nicht widersprach, wenn davon di e Rede war, und sah mich gern, weil ich Fortschritte machte und er dort mehr Mue hatte als in Berlin. Da dies aber den ganzen Sommer hindurch regelmig geschah, so sagte er einst, er msse gestehn, da ich mir seinen Unterricht etwas kosten lie(e), wenn er die Zeit, die Zehrung und das Fuhrlohn rechne, oder ich msse gute Geschfte in Potsdam machen. Er wute nicht, da ich die Reise hin und her zu Fue in einem Tag e vollbrachte und am Abend wieder auf meinem Bau war. Die Sache war mir brigens k eines Weges zu ermdend. Des Morgens ging ich nach drei Uhr von meiner Meierei, un d zwischen acht und neun Uhr war ich in Potsdam in Faschens Stube. Meine Lektion whrete bis gegen eilf Uhr, dann ging ich noch in Sanssouci oder auf den Bergen u mher. Gegen Mittag hatte ich mir die Mahlzeit vor dem Berliner Tore in einem gut en Gasthofe bestellt, und nach dem Essen ging ich bequem wieder nach Berlin, [14 4] wo ich denn abends bei Janny noch sehr lange munter war. Mein Vater und Mutte r und berhaupt niemand wuten von der Sache. Der eigentliche Vorteil aber des Zusuge hens bestand in der angenehmen Einsamkeit, denn auf dem Wege arbeitete ich meist enteils meine Stcke aus, die ich nachher desto gelufiger niederschrieb. Anfnglich hatte ich einigemal ein Fuhrwerk gemietet, doch der Fuhrmann lie mich wa rten; auf dem sandigen Wege kam ich nicht vom Flecke; ich kam spt nach Potsdam, w o dann am Tore unter der Regierung Friedrichs des Groen des Examinierens kein End e war: woher ich komme, wie lange ich mich aufhalte, was ich fr Geschfte habe, und dergleichen. Allen diesen Unbequemlichkeiten wie auch den bedeutenden Kosten de s Fuhrwerks entging ich auf meine Art, bis endlich Fasch die Sache merkte und ke ine Bezahlung mehr fr seinen Unterricht annehmen wollte. Durch diese kontemplative Tendenz meiner Fureisen aber fand sich noch ein Vorteil an, der mir bald sehr ntzlich wurde: durch den Mangel eines Notenblatts oder Kla viers ward ich mit dem wesentlichen Nutzen des doppelten Kontrapunkts bekannt. A
us den Ideen, welche entweder schon vorhanden waren oder zufllig durch vorbergehen de Gegenstnde erregt wurden, entstanden Melodien; durch Umdrehen oder Verkehren d ieser Melodien entstanden neue analoge Ideen, und ich merkte, da der Kontrapunkt fr ein gutes Naturell ein zuverlssiges Medium des Interessanten, Schnen und Tiefen, besonders aber eines reinen Stiles sei. Ein sicherer Geschmack und Gefhl des Wah ren mu in aller Kunst der Grundstein sein und kann daher auch hier nicht entbehrt werden, und so hoben sich mit einem Male alle Zweifel [145] und Miverstndnisse, w elche ich gegen den unschuldigen Kontrapunkt hatte vorbringen hren. So verflog mi r eine Zeit, die mir auerdem wrde unertrglich gewesen sein. [Es war das nmliche Jahr (1783), als ein Erdbeben das unglckliche Messina und Kalabrien verwstet hatte.] Durch mein Hin- und Herlaufen nach und von Potsdam aber entstand noch eine inter essante Bekanntschaft. Einstmals besuchte ich den Hauptmann von Stamford, der ba ld mein intimer Freund ward. Er fhrte mich in das Haus des Anno 1777 verstorbenen berhmten Fagottisten Eichner, wo er tglich zu Mittage speiste, und ich ward sein Gast und einmal fr allemal eingeladen, wenn ich in Potsdam war. Eichner hatte ein e Frau und eine Tochter hinterlassen, welche letztere Sngerin des damaligen Kronp rinzen Friedrich Wilhelms II. war. Seit dem Abgange der Madame Mara im Jahre 178 1 sang sie auch in der groen italienischen Oper zu Berlin die zweiten Rollen. Dies Mdchen war eine treffliche Natur; ihr Geist und Krper waren von einer Bewegsa mkeit und Biegsamkeit, da jeder, der fr etwas gelten oder sich angenehm unterhalte n wollte, dies Haus besuchte. Maria, so hie dies Mdchen, ward von ihrer Mutter nach ihrer Art scharf gehalten, d och regierte jene das Haus, und die Mutter hielt alles Schne und Angenehme, was h ier geschahe, fr ihr eigenes Werk, ja wenn es darauf ankam, machte sie die jugend lichsten Spiele und Kindereien mit, um Marien, die sie gleichwohl sehr liebte, z u gefallen. Da sowohl Mutter als auch die Tochter eine bedeutende Pension bezoge n, bewohnten sie das ganze Haus allein, welches einen artigen Garten hatte. Die b rigen Hausgenossen bestanden in einer alten Kchin, [146] einem Hausmdchen, einem Gr tner und einer Kammerjungfer, die Grete hie und die einen hchst sonderbaren Aufzug machte. Lang,. hager, pockennarbig, mit einem gelben, behaarten Gesichte, kleid ete sich diese Grete und putzte sich durch abgelegten Staat und kleine Geschenke , welche sie von Marien zu dem Zwecke erhielt, auf sonderbar romantische Art in mannigfaltigen Farben nicht ohne Geschmack aus, so da sie in diesem Hause sich au snahm wie eine Art von Negerin in der Suite einer vornehmen Herrschaft. Fr Marien war ich bald eine interessante Bekanntschaft geworden. Sie erfand sehr artige Melodien zu Gedichten, welche Stamford brachte und die zum Teil von seine r Arbeit waren, und sang sie mit unaussprechlicher Anmut; aber sie war nicht ims tande, sie aufzuschreiben. Diese Arbeit verstand ich, und nun war ich hier ein a ngenehmer Gast. Mein erster Vorteil von dieser Bekanntschaft war die Gelegenheit, die Kammermusi k des Kronprinzen zu besuchen, wo zum Exempel die Haydnschen Sinfonien in der hch sten Vortrefflichkeit ausgefhrt wurden. Das groe Konzert war Sonntags, und nun gin g ich auch fter Sonntags nach Potsdam, hrte die Musik, und nach der Musik ging ich zu Stamford, wo ich ein Bett fand und die Nacht bleiben konnte. An einem Sonntage sollte Hndels Messias in Potsdam aufgefhrt werden. Um diesen Tag r echt voll zu genieen, ging ich Sonnabends abends nach sieben Uhr von Berlin ab, u m die Nacht in Potsdam noch ordentlich zu schlafen. Ich kam gegen Mitternacht an , vermite aber beim Schlafengehn meine Brieftasche, welche mir Jeanette verfertig t hatte, und worin eine Menge Briefe von [147] ihr waren. Ich hatte diese Brieft asche etwa eine Meile von Potsdam eines gewissen Geschfts wegen auf die Erde gele gt, damit sie mir nicht entfallen sollte, aber vergessen, sie wieder aufzunehmen . Nun war ich in groer Sorge, und aus dem Schlafen konnte nichts werden. Morgens mit den ersten Strahlen der Sonne ging ich daher von Potsdam zurck, meine Briefta sche zu suchen, deren Rosenfarbe mir entgegenstrahlte, wie ich in ihre Nhe kam un
d darber eine groe Freude hatte. Nun ging ich nach Potsdam zurck, hatte den Tag vie l Vergngen mit Marien, und das Oratorium, welches die erste Hndelsche Musik war, d ie ich hrte, machte einen groen Eindruck auf mich. Nach der Musik ward das Abendes sen bei Marien genommen, wo man sehr munter war; es fiel mir jedoch ein, in der schnen, heitern Nacht nach Berlin zu gehen, weil ich am andern Tage bei guter Zei t hier sein wollte. Meine Zurckreise ward unternommen, doch kaum war ich ber die Brcke gekommen, welche bei Glienicke ber die Havel geht, als sich der Horizont bezog und ein starkes Do nnerwetter, von gewaltigen Regengssen begleitet, herauszog und mich bis auf die H aut durchweichte. Da ich den Weg genau kannte, so war ich wegen der Finsternis n icht eben besorgt, doch fhlte ich zum ersten Male, da ich ohne Waffen war, und ein ungelegener Schauer ergriff mich, als ich daran dachte, da auf diesem Wege vor m ehrern Jahren ein Mann war ermordet worden, wovon das Zeichen bereinandergeworfen en Reisholzes am Wege lag. Es war ein fatales Gefhl der Hilfelosigkeit, und ich w ute in diesem Augenblick nichts weiter zu tun, als da ich meine Handschuh anzog, d ie ich in der Tasche hatte. Indem ich meinen Weg [148] fortging, erblickte ich i n der Entfernung den Schein einer Laterne. Ich verdoppelte meine Schritte, um di ese Reisegesellschaft einzuholen, konnte jedoch dem Lichte nicht nherkommen, bis ich, vom starken Laufen ganz erhitzt, meinen gewhnlichen Gang wieder annahm. Hier bemerkte ich, da ich nicht auf dem rechten Wege sein knne. Der Regen dauerte lang sam fort, und die Gegenstnde wollten sich in der dichten Heide nicht erkennen las sen. Abends vorher hatte ich vier Meilen gemacht, die Nacht wenig geruht und war morgens wieder zwei Meilen gegangen; den ganzen Tag war ich in Bewegung gewesen und ich fhlte Mdigkeit. Der Morgen konnte so gar weit nicht sein, und um in der F insternis nicht weiter in die Wildnis zu gehn, setzte ich mich auf einen breiten Granitstein, bei dem ich eben hielt, um die Morgenrte hier zu erwarten. Ich hatt e ein starkes Einlegmesser bei mir; dies zog ich hervor, hielt es fest als Waffe in der Hand, wenn mir etwas widerfahren sollte, und so sa ich. Und so schlief ic h ein. Mir trumete, ich kam in Jeanettens Stube, wohin ich mich gegen etwas rette n wollte, das mich verfolgte. Sie sa und malte etwas, das sie mir nicht zeigen wo llte; berhaupt schien ihr meine Erscheinung nicht angenehm zu sein. Adele sa an ih rem Klaviere und spielte, doch das Klavier hatte die Gestalt eines Kastens, wori n Orangenbume gepflanzt waren. Sie spielte Variationen, die ich ihr gemacht hatte , so schn, da ich sie kaum erkennen konnte. Der Vater trat in die Stube und tadelt e die Variationen. Gleich darauf trat Marie in das Zimmer, lachte unmig und fiel t ot zur Erde. Grete kam gerannt, bellete und pelferte wie ein Hund, ri von dem ein en Baume eine Orange ab und warf nach Jeanetten. Die Frucht fuhr [149] gegen die Wand und barst auseinander, da die Teile von beiden Seiten flogen und einen unau sstehlichen Geruch gaben. Grete sah bunt aus wie eine Eidechse, warf mir angeneh me Blicke zu und ruschelte zur Tr hinaus. Bertha erschien; zur Tr war sie nicht he reingekommen; sie hatte Blumen in der Hand, die ich nicht kannte. Mit der andern Hand zog sie Marien zu sich, und in dem Augenblicke waren beide verschwunden. So wachte ich auf. Die Sonne war in voller Schnheit da, und nun konnte ich bemerk en, da ich auf dem rechten Wege auf einem wohlbekannten Steine sa, den ich von Jug end an unzhlige Male gesehn hatte; und so setzte ich meine Reise fort. Durch die Erhitzung, Nsse und das kalte Nachtlager hatte ich mir eine starke Unplic hkeit zugezogen, durch welche ich mich jedoch nicht von meinem Bau entfernen lie, weil ich fest entschlossen war, das groe Haus vor dem Winter unter's Dach zu sch affen. Zu meiner brigen Ttigkeit fand sich nun das Bedrfnis ein, zu lesen. Jeanette hatte bald die Entdeckung gemacht, da ich die bedeutendsten neuern Schriftsteller nicht kannte. Sie sprach hufig von und aus Bchern, ich konnte dagegen nur aus dem Herze n antworten, wenn mir solches eine Antwort gab; auer dem war ich stumm, wenn nich t die Rede von Musik war. Sie gab mir nun Lessings und Wielands Schriften zu les en. Ihre Leidenschaft war heftig, sie liebte mit Ungestm und verlangte das nmliche von mir. Ich arbeitete mich ab und war geteilt zwischen Neigung und Geschften; s
onst war ich ihr ergeben und wre durchs Feuer gegangen um sie. Sie warf mir Klte v or, zog in ihren Briefen gegen die Mnner los und schalt sie unwrdig der Liebe [150 ] eines liebenden Weibes. Dies gab manchen kleinen Streit. Endlich gab sie mir m eines nachherigen gttlichen Freundes Goethe Schriften zu lesen. Das erste waren d ie Leiden Werthers. Schon seit mancher Zeit hatte ich die Sensation dieses Buchs bemerkt und kannte es noch nicht. Es lag eine gute Weile bei mir; ich kann sage n, ich frchtete mich, es zu lesen, da Jeanette mir in allen ihren Briefen die Lie be des jungen Werther gro und gewaltig pries. Er allein schien ihr ein wahrer Men sch, ein wrdiger Liebhaber, und Lottens ward mit Klte gedacht. Eines Abends legte ich mich sehr ermdet auf mein Bett. Neben demselben lag das Buch. Ich nahm es und las die kurze Vorrede, welche mir wie Balsamtropfen auf dem Herzen zerflo. Ich l as weiter, und fort war meine Mdigkeit, mein Schlaf. Es war meine Denkungsart, me in Ausdruck, meine Schreibart, die ich hier fand. Das Bchlein war lngst mein Freun d, wie ich keinen hatte und keinen zu suchen wute, und der Verfasser mute es auch sein. Auch ich war verpflanzt auf fremden Boden, liebte, was nicht heimisch war, und ganz natrlich ging die Wirkung des Buches in meine Briefe an Jeanetten ber, u nd nun schwrmte ich mit ihr zugleich ber ein en Gegenstand. Doch sie sprach von St erben, von gemeinschaftlicher Aufopferung: das brachte mich zum vollen Gefhl mein es Lebens, und nun stritten wir wieder. Ich stellte ihr das Leben vor als ein Ka pital, das Zinsen tragen knne, und die Unsterblichkeit als die Fortsetzung eines lebendigen Zustandes. Ich tadelte den, der sich selber das erste und letzte Mitt el entri, etwas fr seine Liebe zu tun. Htte Werther Alberten umgebracht um Lottens Besitz, so htte er allerdings ein Verbrechen begangen, allein dies wre doch eine T at [151] gewesen. Man msse nichts allein besitzen wollen, was man nicht allein er werben knne. Dagegen sagte Jeanette: Werthers Aufopferung sei eine Heldentat und lasse sich d eswegen nicht nach allgemeinen Moralgesetzen beurteilen. Dies konnte ich zugeste hen, indem ich die Nachahmung solcher Heldentaten verwarf, woraus nichts entsteh n kann; einen Liebhaber, der Werthern nachahmen knne, verglich ich mit einem Male r, der Bilder kopiere und eben deswegen kein Knstler heien knne. Wir gerieten ber dies und hnliche Kapitel in Streitigkeiten, ohne einig zu werden, und mein Beispiel, was ich an der Malerei gezeigt hatte, war etwas bel aufgenomm en worden, denn Jeanette, die selbst angefangen hatte zu malen und Bilder kopier te, meinte, ich solle hbsch bei der Sache bleiben und nichts in den Streit mische n, was nicht darein gehrte. Die Malerei habe mit Werthers Geschichte soviel gemei n wie die Musik. Selbst die Knste htten nichts miteinander zu schaffen; jedes mte fr sich sein und beharren. Ich empfand wohl, wohin das gehrte und widersetzte mich t apfer, indem ich behauptete: es gebe nur eine Kunst; die Malerei oder Musik seie n nur verschiedene Felder, Teile dieser allgemeinen Kunst; man msse die Grenzen k ennen, aber auch wissen, wie's drben ausshe; ja, der Maler, welcher musiziere, sow ie der Tonknstler, welcher male, das seien die echten, rechten Knstler; dagegen de r trockene historische Abschreiber wie der Notensetzer niemals aber im Geist und (in) der Wahrheit ein Knstler genannt werden knne. Das Reden und Schreiben hierber ward so ernstlich, da sich Jeanette zuletzt ihre Maler und schnen Geister, die tgl ich ab- und zugingen, zu Hilfe nahm; [152] auch der Vater mischte sich in die Sa chen, und diese waren alle gegen mich. Ich hatte nur Adele auf meiner Seite, die aber fast bestndig schwieg und mir blo Beifall zulchelte, wenn ich recht glhend spr ach. Man forderte mich auf, zu erklren, was es denn heie: ein Maler solle musizier en. Benda und mehrere Musiker htten das Brllen des Lwen, das Zischen der Schlange, Krhen des Hahns musikalisch auszumalen gesucht; ob ich denn dies fr schn halte, nic ht in den allgemeinen Tadel solcher Pinseleien einstimme? Ich sahe wohl ein, da i ch nicht verstanden werden konnte, und verstummte. Man triumphierte, und ich mute manche Neckerei darber anhren. Da mir's jedoch schien, als wenn ich auch wohl Unr echt haben knnte, wenn ich Dinge in der Tiefe ahnete, die von andern obenauf mit leiblichen Augen bemerkt werden wollten und um desto schwerer zu bestreiten ware n, so ging mir diese Sache gewaltsam im Kopfe herum. Indessen komponierte ich fr Adelens Stimme das Wielandsche Gedicht Serafina. Das Gedicht schien meinem Zustand e palich; auf diesen Grund dachte ich meine Figur so zu gestalten, ihr Bild so er
kennbar herzustellen, da man von dem Ton der bloen Stimme ergriffen, gerhrt und hin gerissen werden solle. Meine Szene war im Scheine des Vollmonds; auch diesen wol lte ich darstellen, da jeder seine Nhe fhlen msse. Adele sang das Stck, wie sie sollt e; auch sie war in hnlicher Lage, indem sie einen Mann liebte, den sie nicht sehn durfte. Das Stck ward produziert und gelobt, doch von meinen schnen Heimlichkeite n erriet kein Zuhrer etwas, das er htte wieder verraten knnen, als Jeanette, die me ine Intention kannte und sich manchmal darber lustig machte, welches mir bitter w ehe tat [153] und mir ihren Vorwurf erneuerte, da ich sie nicht hei genug liebte. Ich gab mir (wie es auch klingen mag) nach meiner Art wirklich Mhe, um Jeanetten von meiner Liebe zu berzeugen, was sie denn geschehen lie. Seit einiger Zeit kam ein Maler in das Haus, der bei Tische fter gegen das Hinlau fen der Deutschen nach Italien deklamierte, indem er behauptete, was man nicht d ahin bringe, knne man weder dalassen noch wieder mitbringen; die Natur sei berall, und was ein guter deutscher Knstler in Italien lernen knne, knne er auch zu Hause vollkommen ebensogut lernen; er selber, setzte er einst hinzu, sei in Italien ge wesen und wisse davon am besten zu sagen. Ich konnte mich nun nicht mehr halten und erhub ein so unbndiges Gelchter, da meine Unbescheidenheit eine groe Unzufrieden heit bewirkte, die mir vielleicht bel wrde bekommen sein, wenn der Schwtzer so viel Herz und Eifer fr die Kunst gehabt htte als ich. Er nahm jedoch den Ton des wohlg ezognen Mannes gegen einen Jngling an, und nach aufgehobener Tafel fragte er mich ruhig, was ich gegen seine Meinung einzuwenden habe, da ich nie in Italien gewe sen sei? Ich sagte, eingewendet htte ich ja nichts; gelacht aber htte ich, indem i ch mir in dem Augenblicke vorgestellt htte, wie possierlich ich mir selber vorkom men wrde, wenn ich nach meiner Zurckkunft aus Italien ein solches Gestndnis vor mir abzulegen gezwungen sein wrde. brigens sei ich seiner Meinung nicht entgegen und b erzeugt, da man nach Italien etwas mitzunehmen habe, was sich jedoch leicht trans portieren lassen werde. Hierber beruhigte sich der Pinsel vllig, und wir waren den Abend noch sehr aufgerumt. Ich war um die jetzige Zeit wirklich vergngt. Mein [154] Bau ging gut, und vor de m Winter hoffte ich noch Meister zu werden; doch bemerkte ich an Jeanettens Lieb e einigen Nachla. Ihre Briefe, die sonst voller Glut und wirklich schn waren, sing en an wortreich und verlegen zu werden. Sie schrieb jetzt fter franzsisch, und von Italien war keine Rede mehr. Ich war arglos genug, dies alles auf die Rechnung meines geschftigen Treibens zu schieben und mir allein die Schuld beizumessen, ge stand ihr auch brigens gern zu, was sie gern hrte, da Mnner so nicht lieben knnen. Do ch schrieb ich ihr tglich [und unterhielt einen eignen Burschen, der bei sonstige r Ungelenkigkeit der beste Brieftrger von der Welt war,] und unterrichtete sie vo n dem Fortgange meines Baues, woran sie gar zu wenig Anteil nahm, obgleich ich s elbst ihr sorgfltig verschwiegen hatte, mit welcher groen Anstrengung meiner smtlic hen Krfte ich meinem lieben Vater dies saure Opfer brachte. An einem Sonntag ging ich mit Adele allein im Garten auf und ab, die mir ihr gep retes Herz ausschttete. Als ich ihr trstlich zugesprochen hatte, kam das Gesprch auf Jeanette. Ich gestand, da ich Jeanetten nicht mehr so fnde wie sonst; meine Neigu ng zu ihr vermehre sich, und die ihrige schiene abgenommen zu haben. Adele sagte , sie halte mich fr stark genug, Erfahrungen zu bestehn, die ihren Mann forderten , aber sie she mit tiefer Betrbnis die Zeit kommen, da sie eines so geflligen Freun des, als ich sei, werde entbehren mssen. Ich suchte sie aufzuheitern, indem ich s agte, sie knne ja die Reise mitmachen nach Italien und werde hoffentlich bei ihre r Schwester und mir nicht schlechter aufgehoben sein als in dem Hause ihrer Elte rn. Ach, mein Freund, rief sie aus, glauben Sie denn noch, da [155] Jeanette mit Ihn en wird nach Italien gehn? Ins Feuer geht Jeanette mit mir! antwortete ich, und wehe dem, der mich etwas anderes will glauben machen! Sie fuhr vor Schreck zusammen u nd schwieg erst. Dann fing sie wieder an, von ihrer unglcklichen Liebe zu reden, bis wir zurck zur Gesellschaft kamen. Beim Zuhausegehen fehlte es mir nicht an Mue, Adelens Rede zu berlegen; ich erschr ak davor. Sollte dir, dachte ich, dies Unglck widerfahren? Soll es um deinetwille
n keine treue Seele mehr in der Welt geben? Es wre entsetzlich! Indessen fate ich hier auf der Stelle einen festen Entschlu. Du hast, sagte ich mir, zwei Dinge vor dir: den Bau des Hauses und den Unterricht bei Fasch. Wirst du in diesen Dingen gestrt, so bist du nicht mehr ganz, und alles geht nicht mehr vonstatten, und du kommst endlich um deine Reise nach Italien. So beschlo ich, auf meinem Wege fort zugehn und mich nichts anfechten zu lassen, bis mein Bau fertig sei; dann werde sich alles lsen. In meiner Musik war ich unterdessen ernsthaft fortgeschritten, und Fasch fing an , mir aus freien Stcken seine Zufriedenheit zu bezeugen. Anfnglich hatte er mich m achen lassen, wozu ich Lust hatte; jetzt aber trieben wir die ordentliche Schule , welches mir anjetzt umso lieber ward, je leichter mir die Arbeit abging. Eine Zeit lang hatte ich vierstimmige Chorle geschrieben, dann sahe ich mich im fnfstim migen Satz um; dann gingen wir zu den Kontrapunkten ber, von diesen zum Kanon, de r mir gewaltige Freude machte, weil ich diese Tierchen auf meinen einsamen, sand igen Spaziergngen nach Potsdam ausheckte und darin ganz gewandt wurde. Zuletzt ha tten wir uns an den dreistimmigen Satz gemacht, [156] den ich aber nicht wie das gewhnliche Trio fr Instrumente, sondern mit lauter Singstimmen auf Textworte ben m ute, welches denn schon eine der schwersten Arbeiten war. Von hier war ich auf di e sogenannten Charakterstcke und franzsischen Tnze bergegangen, und damit sollte, wa s man eigentlich die Schule nennt, beschlossen und die Fuge angefangen werden, w elches ich mir denn vorbehielt, bis ich etwas mehr in Ruhe sein mchte. Meine Kreuzgewlbe und Rauchfnge waren endlich vollendet, und am 1. Dezember des Ja hres 1783 ward ich auf meinen angefertigten Meisteraufgaben zum Meister gesproch en und aufgenommen. Ein kostbares Gastmahl krnte diese Feierlichkeit, und nun htte ich knnen der vergngteste Mensch unter der Sonne sein. Mein Vater wartete nur dar auf, mir das Handwerk mit seiner bedeutenden Kundschaft zu bergeben, die das ganz e Jahr vollauf Reparaturarbeiten gab, ohne die neuen dazukommenden Bauten. Jedoc h war mir nie so bel zu Mute gewesen als eben jetzo. Ich war unzufrieden, ich tra uerte, ohne recht zu wissen, warum, wozu noch folgender Vorfall kam: Ich besa einen braun getigerten schnen Hhnerhund, den mir Jeanette geschenkt hatte, und war sehr an dieses Tier gewhnt, das mir gleichwohl vielen Verdru verursachte, weil meine Mutter es nicht leiden konnte; denn es zerfra meine Wsche und Kleidung sstcke, wenn solche auf dem Stuhle lagen, und vor kurzem hatte es einen von Jeane ttens Briefen, welcher vom Tische gefallen war (es war der erste ihrer Briefe), gnzlich aufgefressen. Dieser Hund ward krank und zehrte so ab, da ich mich [157] g entigt sah, mit ihm zum Scharfrichter Brand zu gehn, der als ein geschickter Tier arzt bekannt war. Der Mann gab mir Arzeneien und Verhaltungsregeln, welche ich aufs genaueste befo lgte, und tglich ging ich mit meinem Hunde zu ihm, wodurch mich der alte Mann lie bgewann und mir vieles von seinen Taten und Faten erzhlte, mich auch gelegentlich mit seinem ganzen richterlichen Apparat bekannt machte. Mein Hund ward bald so schwach, nicht mehr mit mir gehen zu knnen, weshalb ich ihn zum Scharfrichter tra gen mute, der mir endlich sagte, er sehe wohl, wie sehr ich den Hund liebte, aber er knne mir wenig Hoffnung zur Besserung geben. brigens solle ich vorsichtig sein und ihm den Hund dort lassen, weil sein bel ansteckend sei fr andere Hunde sowohl als auch fr Pferde; er wolle sein Mglichstes tun, um den Hund herzustellen. Dies schlug ich ihm rund ab und erklrte, da ich den Hund wieder mitnehmen msse. Endlich sagte er sehr gelassen und mitleidsvoll, er drfe den Hund nicht wieder in die Sta dt lassen. Der Hund habe den Rotz, und dies knne eine Seuche ber die Stadt bringen , wofr er verantwortlich sei. brigens knne er mich versichern, da der Hund morgen ni cht mehr lebe. Ich war untrstlich ber dieser Nachricht, meinen Augen entstrzten bittre Trnen, und d er alte, gute Mann setzte sich zu mir und weinte mit mir ber meinen Hund, welcher auch am andern Tage starb. Ich wrde diesen Umstand nicht berhren, wenn ich den bi ttern Schmerz vergessen knnte, welchen mir der Tod dieses Hundes gab.
Jeanettens Betragen gegen mich wurde immer gemessener; ich erhielt seltener Brie fe, und diese waren von [158] trauriger Klte. Eines Nachmittags ging ich zu ihr u nd fand sie allein. Ich forderte eine feste Erklrung, was dieses ihr Betragen bed euten solle. Ob sie sich fr beleidigt halte, und was sie verlange, das ich fr sie tun knne. Sie fing eine lange Erzhlung an, von der ich nichts verstand. Endlich fr agte ich sie, ob sie einen andern liebe. Sie knne versichert sein, er solle mir d afr ben. Ich hatte, indem ich dies sagte, einen sehr groen eisernen Nagel, der auf d em Fenster lag, in die Hand genommen; und indem sie sagte, ihr seien die Augen a ufgegangen, sie knne es nicht ber ihr Herz bringen, mich unglcklich zu machen; ich sei ein braver Mensch, sie msse sich schmen, sie sei meiner nicht wrdig, schlug ich den Nagel mit solcher Kraft in das Fensterbrett, da die Spitze unten durchgefahr en war und ich ihn mute stecken lassen. Sie war davon aufs hchste erschreckt, wein te laut und rief nach ihrer Schwester. Schlange! rief ich aus, ich will Dich und De ine ganze Sippschaft zertreten; aber erst will ich wissen, von wem mir diese Sch mach kommt! Und so ging ich fort. Am andern Tage erhielt ich von Adele einen Brief, worin sie mich aufs rhrendste b at, ihre gute Schwester nicht zu krnken; sie sei allerdings darinne zu tadeln, mi ch nicht eher mit dem wahren Verhltnisse ihres Hauses bekannt gemacht zu haben; s ie habe jedoch Verschwiegenheit gelobt, welche sie halten msse, und dergleichen m ehr. Verschwiegenheit gegen mich (schrieb ich ihr zurck), in einer Sache gegen mich, s eit Jahr und Tag, sei ein strafbares Vergehn. Um ihre[n]twillen htte ich mir's in ihrem Hause gefallen lassen, nicht aber um des nchternen, albernen Knstlergeziefe rs, was sie um sich her zu versammeln wisse. Sie solle die Kerls mit der Fliegen klatsche [159] verjagen und Strmpfe stricken, als Farben und Zeit an erbrmliche Ge sichter wegwerfen, die nichts vom Menschen htten als die Zeichen seiner Erniedrig ung. Der ganze Brief war voll Wut und Galle, welche sich schon seit zwei Monaten angesammelt hatte. Denn die Herren Maler, Kupferstecher und schnen Geister, welc he ich dort fand, waren geneigt, ihre Bilderkunst allein fr Kunst gelten zu lasse n, worin sie sich untereinander treulich beistanden, welches mir groen Verdru mach te; schon deswegen, weil sie mich schlechtweg fr einen Dilettanten nahmen, der si ch die Beschlsse der Knstler von Profession mte gefallen lassen. Daher hatte mich au ch ein solcher Ha gegen allen Dilettantismus ergriffen, da ich berall dagegen offen zu Felde lag und behauptete, da er der Kunst und allen andern gesellschaftlichen Getrieben gleich gefhrlich sei, Knstlermanier in die Sitten berspiele und das Jmmer liche, Halbe und Zahme ertragen lehre. Was der Schler pfusche, toleriere der Meis ter, und was diesem denn unter Umstnden gut genug wre, solle der ganzen Welt allem al recht sein. Als meine Leidenschaft ausgewtet hatte, ging mein Herz in Traurigkeit ber. Es war Winter, feucht und schneeigt. Meine Mutter bemerkte meine immer mehr zunehmende Trbsinnigkeit nur zu bald, und da diese kein Ende nahm, stellte mich mein Vater d arber ernsthaft zur Rede. Er habe gehofft, sagte er, da zwei Jahre solcher Sorge u nd Qulerei mir eine heitere Zukunft bereiten werden, und nun, da ich mich verdien ter Ehren zu erfreuen habe, liee ich mich von meiner angebornen Mannheit entferne n, indem ich mich einem kindischen Schmerze ber den Tod eines schlechten Hundes be rlie. [160] Er schlug mir vor, eine Reise zu meiner Schwester zu machen, die im M agdeburgischen wohnte, und hoffte, dies wrde mich erheitern. Ich trat meine Reise an und fuhr ber Potsdam, um mich einige Tage daselbst aufzuh alten. Grete machte mir den Wagen auf. Sie mssen, sagte sie, bei uns absteigen und b leiben. Der Hauptmann (Stamford) ist verreiset und kein Mensch dort im Hause. Mar ie sagte das nmliche, und die Mutter, welche mich sehr wohl leiden konnte, betrug sich, als wenn es bereits abgemacht sei, da ich im Hause schlafen sollte. Man ha tte mir ein Bett in die sehr freundliche Gartenstube gesetzt, welche einen Ofen und einen Kamin hatte. Wir waren sehr aufgeweckt und munter; gegen Abend fanden sich noch einige Freunde ein. Marie sang einige Arien, und man ging auseinander.
Mein Schlafzimmer fand ich aufs beste erwrmt, und Grete hatte mir Kaminfeuer bere itet. Sie war unermdlich zuttig und heiter, und wenn sie kam und von mir ging, hrte ich sie Stellen aus Mariens Arien ganz schrecklich nachquieken. Ich hatte mich halb entkleidet vor das angenehme Kamin gesetzt und in tiefe Geda nken an die letzten Begebenheiten versenkt. Erklrbar war mir Jeanettens Betragen durchaus nicht; ich mochte hin- und herdenken, soviel ich wollte. Es blieb mir d aher immer der erste Gedanke stehn, sie habe blo in Ermangelung eines Bessern ihr einstweiliges Spiel mit mir treiben wollen, und mein grter rger war jetzt, die Gel egenheiten nicht benutzt zu haben, wo ich sie zur Meinigen htte machen knnen, und die mir jetzt ganz absichtlich schienen. Drber war ich auf dem Stuhle eingeschlum mert, als [161] die Tr pfiff und mich wieder erweckte. Grete trat herein und hatt e sich auf eine so lcherlich bunte Art reizend gemacht, da mir augenblicklich mein Traum einfiel, den ich auf dem harten Feldlager des Potsdamer Weges vorigen Som mer getrumt hatte. Sie fing sogleich an zu reden und sagte, sie sei voller Scham b er diesen nchtlichen Besuch, den sie jedoch gewagt habe, um mir ein sehr wichtige s Geheimnis zu entdecken, was ich aber um alles in der Welt keinem Menschen wied er sagen solle. Der erste Eindruck dieser Erscheinung hatte mich wirklich erschreckt und noch me hr verstimmt; ich sagte ihr daher, da ihr Geheimnis nirgend bler aufgehoben sein kn ne als bei mir; ich sei entfernt von aller Neugierde, ihr Geheimnis zu wissen. Da s wollte ich nur hren, sagte sie. Nur die Neugierigen plaudern aus und verraten; da s wei ich von mir selber. Wissen Sie demnach: Marie ist nicht mehr frei; Marie is t versprochen mit dem Hauptmanne. Wenn Sie also Absichten haben auf sie, so komm en Sie zu spt. Doch trsten Sie sich! Es gibt der guten Mdchen mehr in der Welt. Mensch! rief ich, bist Du toll, dem [fremden Manne, dem] Gaste Deines Hauses Deine Herrschaft zu verraten? Du verdienst den Scheiterhaufen, Hexe, und wenn Du nicht gleich gehst, sto' ich Dich in den Kamin und brenne Dich zu Rattenpulver! Jesus Maria! Wie Sie einen erschrecken knnen, rief sie aus; , was soll ich denn verr aten? Was ich lngst wei! antwortete ich. Und was die ganze Stadt wei, setzte sie ur die Mutter nicht. Ich wollte Ihnen auch nur sagen, da Sie es dieser nicht sage n sollten. Du hast mir nichts zu sagen, und ich nichts von Dir zu hren! Hebe Dich w eg von [162] mir! Ei, wer wird denn so mit einem Mdchen reden? Ich werde Ihnen kein Leids tun, aber ich bitte Sie um Gotteswillen, hren Sie mich an, stoen Sie mich n icht von sich! Ich bin wahrhaftig ein treues Mdchen, und Sie sollen niemals Ursac he haben, wieder auf mich zu schelten! Nun, was soll ich also erfahren? Mach' fort ! Ja, wenn Sie mich nicht so erschreckt htten! Nun wei ich nicht, wie ich anfangen s oll! Das eigentliche Geheimnis bestand nun darinne, da Grete mir heute nach Mitternach t ihre entschiedene Neigung zu mir frmlich zusagte, als wenn ich schon einmal dar um angehalten und sie sich nun entschlossen htte. Ihre Mutter war eben gestorben, von dieser hatte sie dreihundert Thaler geerbt. Dieses Geld legte sie mir hierm it zu Fen wie ihre unholde Person, und nun wre die Sache abgemacht. Ich war wirklich in die uerste Verwirrung geraten. Die ganze Geschichte hatte so m einen tiefsten Widerwillen erregt, ja ich fhlte mich so herabgesetzt durch die un erwartete Tollheit des Mdchens, da ich vor Scham und rger auch nicht einmal Nein sa gen wollte. Sie sprach noch eine ganze Weile, und endlich ging sie ruhig von mir , indem sie sagte, ich solle es mir reiflich berlegen, denn mit Marien knne doch n ichts werden. Jeanette! Jeanette! rief ich aus. Wie martert mich deine Untreue siebenfach! Eine Sa che, die ich ihr als einen Spa wrde haben erzhlen knnen, wtete jetzt wie Gift und Sta hl in meinen Eingeweiden. Ich sah mich fr einen verlornen Menschen an. Eine Grete durfte mir das bieten, weil eine untreue Geliebte mich verlie, fr die ich mein Le
ben zehnfach hingegeben htte. [163] Ich konnte nicht einschlafen. Meine Scham ber diese vllig unnatrliche Begeben heit wuchs mit jedem Augenblicke. Wo ich mich hier sehn lie, glaubte ich, wrde man mir's abmerken, da ich ein Verlassener, Verratener wre, der sich von allen alles msse gefallen lassen. Ich beschlo daher, keinem Menschen davon zu sagen und andern Tags von Potsdam abzureisen. Als ich morgens beim Frhstck erschien, sagte mir Marie, des Hauptmanns Kammerdiene r sei gekommen und habe seinen Herrn angemeldet, der gegen das Abendessen zurck s ein werde. Sie haben, setzte sie hinzu, einen allerliebsten Wagen. Lassen Sie uns d em Hauptmann entgegenfahren! Mir war dieser Vorschlag nicht unwillkommen, weil ic h gleich weiterfahren wollte. Die Mutter protestierte zwar gegen die Unschicklic hkeit der Sache, doch Marie wute es zu drehen, da ihr Wunsch erfllt wurde, und nach Tische fuhren wir ab. Wir waren dem Hauptmann gegen zwei Meilen entgegengefahren; er kam nicht. Wir ke hrten daher zurck, um die Mutter nicht zu ngstigen, weil es schon dunkelte. Auf dem Rckwege sagte Marie: Sie kommen mir heute so feierlich vor! Sagen Sie mir, was ist Ihnen? Nicht wahr, es ist Ihnen unangenehm, mit mir zurckkehren zu mssen? Ich ergriff ihre Hand und beteuerte, da ich in keines lebendigen Menschen Gesells chaft lieber sei als in der ihrigen, wo mir noch immer wohl gewesen wre. Sie soll e sich daher keine Sorge machen, denn Zeit htte ich jetzt fr ein ganzes Menschenle ben brig. Geringeres knne ich ihr nicht opfern. Das ist ja ganz entsetzlich! sagte s ie, Sie sprechen ja wie ein Titanensohn! Wer wird solche frechen Blasphemien ber s eine Zunge bringen! Sagen Sie mir, fuhr sie fort, doch [164] Sie werden mich fr seh r unbescheiden halten! Aber ich halte mich verbunden, Sie um etwas zu fragen, da s Ihr Wohl betrifft, Sie mgen es nehmen, wie Sie knnen. Ich versetzte schnell: Frage n Sie, was Sie wollen, nur nichts aus Berlin! Sagen Sie mir demnach: Haben Sie Gre te versprochen, sie zur Frau zu nehmen? Gott des Himmels und der Erden! schrie ich laut, sind auch Sie von der verdammten Tollheit angesteckt! Wie kommen Sie zu der Frage, die mir die Eingeweide umdreht?
Marie lachte auf, da es wie eine Trompete schmetterte und konnte gar nicht aufhren ; sie arbeitete mit den Fen, schlug mit dem Kopfe auf und nieder und gebrdete sich wie unsinnig. Haben Sie denn, fragte sie, Greten beschenkt? O ja, sagt' ich. Habe hr ein kostbar gesticktes Umschlagetuch gegeben? Ja! Ein sehr artiges Halsband? J n Sie ihr nicht einen Brief voll Liebesversicherungen geschrieben? Nimmermehr! Und d och, der Brief ist von Ihrer Hand, die ich kenne. Ich habe den Brief und kann Ih nen solchen zeigen! Nein! rief sie wieder tobend aus, es ist kstlich, es ist einzig ; es ist der erste Roman des Jahrhunderts! Ich war auer mir vor Schreck, denn nun mute ich Marien einen Teil meines Verhltniss es mit Jeanetten erzhlen. Die Sache aber verhielt sich so: Den Tag nachher, als i ch Meister worden war, hatte ich das Tuch und das Halsband fr Jeanetten gekauft u nd einen Brief dazu geschrieben, der ihr diese Stcke zueignen sollte. Der Brief l ag zusammengefaltet und unversiegelt da, ohne Aufschrift, weil ich ihn selber ha tte abgeben wollen. Inzwischen fiel die Szene bei Jeanetten vor, bei welcher [16 5] ich den Nagel eingeschlagen hatte. Am folgenden Tage kam Grete und brachte mi r von Marien aus Potsdam eine Schachtel, worin eine herrliche Baummelone enthalt en war, und einen versiegelten Brief, worin nichts als die lieben Worte standen: Guten Morgen! Der freundliche Gru und der Anblick der schnen Frucht wirkten so bals amisch auf mein erzrntes Herz, da ich Marien dafr einige dankbare Worte schrieb und versiegelt auf den Tisch legte. Ich wute in diesem Augenblicke des Wohlwollens n icht, wie ich der angenehmen Botin genug Liebes erweisen sollte. Mein Herz war m it der Welt ausgeshnt. So fielen mir Jeanettens Geschenke in die Augen; indem ich nun das Tuch, worin das Halsband geschlagen war, an Greten schenkte, sagte ich: Das ist fr Ihre Mhe, und da liegt auch der Brief auf dem Tische! Grete nahm, was ic h ihr gab, und kte mir die Hand, doch statt des Briefes an Marien, den ich dieser
nachher mit der Post nachschickte, eignete sie sich den unversiegelten Brief an Jeanetten zu, der allerdings zu dem eben verschenkten Pakete gehrte und den die e rfreute Kreatur an sich selbst gerichtet glaubte, denn an Marien konnte er nicht sein, und so war die sonderbare Geschichte entstanden. Nun wollte ich auch Gret ens nchtlichen Besuch erzhlen, sie hatte es aber schon selber getan und mich dabei als einen wahren Teufel geschildert, worber Marie in voller Lebenslust lachte un d nicht satt werden konnte. Als wir nach Potsdam zurcke kamen, fanden wir den Hauptmann schon. Er war einen a ndern Weg gekommen, und Marie konnte sich nicht enthalten, nach Tische, da die M utter nach gewohnter Art eingeschlafen war, dem Hauptmanne die verfluchte Geschi chte zu erzhlen, welche [166] mir jedoch jetzt leichter war zu hren, da Marie es be rnahm, Greten ber die Sache zu beseitigen, welche jedoch gewaltige Sprnge machte, ihren Brief im Stiche zu lassen. Nach einigen Tagen reiste ich zu meiner Schwester [nach Calbe an der Saale], die sich sehr freuete, mich nach acht Jahren wiederzusehn. Ich hatte von meinem Vat er einen Urlaub auf drei Monate bekommen. Als ich aber einige Wochen hier war, d ie freilich gnzlich der Musik gewidmet wurden, fhlte ich die Einfrmigkeit des Leben s an einem kleinen Orte im Winter unter einer Sippschaft von lauter Kaufleuten u nd Friesmachern nur zu sehr. Denn mein Schwager und meine Schwester, deren Gast ich doch war, die sich daher Mhe gaben, mich zu unterhalten und keine Kosten spar ten, mir meinen Aufenthalt angenehm zu machen, sahe ich nicht auer der Mahlzeit. Die ganze brige Zeit war ich einsam und arbeitsam auf meiner Stube oder bei dem S tadtpfeifer, der ein geschickter Violoncellist war und auerordentlich gut Trompet e blies. Ich komponierte hier einige Sinfonien, Klaviersonaten und ein Violinkonzert. Es ward ein Konzert in dem Hause eines reichen Kaufmanns veranstaltet, wo diese Sac hen mit Beifall gespielt wurden und mich als einen Komponisten erkennen lieen. Es waren zu diesem Konzert alle Honoratioren der Stadt eingeladen. Die Tochter des Brgermeisters sang eine reizende Arie, zu der ich das obligate Fagott auf der Br atsche spielte, die soviel Beifall erhielt, da sie wiederholt wurde. Nach dem Kon zert war ein groes Gastmahl, und nun wurde auch getanzt. Ich tanzte mit meiner Sng erin, und meine Schwester hielt uns fr ein treffliches Paar. Das Mdchen war [167] ein blhendes, blauugiges, zrtliches Wesen von neunzehn Jahren, an Gestalt und Wuchs etwa das Gegenstck zu Alinen; ihre Stimme war rein und angenehm, doch ohne metal lischen Klang. Bis jetzt hatte ich knnen den ganzen Vormittag ruhig meinen Studien weihen. Von n un an war ich fast keine Stunde allein, und meine Schwester war bemht, zwischen m ir und der Tochter des Brgermeisters, wo sie auch schon hingehorcht hatte, eine H eirat zu stiften. Ich wei nicht, was mich abhielt, meiner Schwester eine feste An twort zu geben, und die Sache ging wirklich weiter, als ich wollte. Wo ich mit d em freundlichen Wesen zusammenkam, wurde die Sache als abgemacht angesehn, und d as gute Mdchen selber war sehr vertraut und liebevoll gegen mich, sprach davon, w ie gern sie einst Berlin sehn werde, welches jedoch alles meiner Unbefangenheit entging, und meine Schwester sowohl als andere Weiber freueten sich schon auf ei ne tchtige Hochzeit, indem sie mir tglich dergleichen Reden zu hren gaben. Endlich kam der Stadtpfeifer zu mir, den man fr meinen vertrautesten Freund hielt. Er war abgeschickt, und nun kam die Sache ins Klare, indem ich demselben meine Unschul d darlegte und geradezu sagte, ich sei nicht mehr frei. Von dem Tage an vernderte sich die Luft ganz und gar, und wie der Sommer auf den Frhling, so folgten nun kh le Tage auf warme; selbst in meiner Schwester Hause war es nicht mehr wie vorher . Man war sonst in die Kirche gegangen, um mein Orgelspiel zu hren; der Organist selber gehrte zu meinen Bewundrern; wo ich hinkam, hatte man mein Phantasieren au f dem Fortepiano mit Bewundrung meines Genies bemerkt; man hatte mir Gedichte ge geben, die ich komponiert [168] hatte; alles das war fr den kleinen Ort etwas Bes onderes, und daher hatte man sich denn auch meine dreiste Sprache berall gefallen lassen, ja man hrte mich mit Aufmerksamkeit an.
Alles das war mit einem Male vorbei. Dagegen fing man an, jeder nach seiner Art, auszulegen und zu deuten, was ich hier oder dort gesagt oder getan hatte. Bei einem frhlichen Mahle in dem Hause eines Kaufmanns war der Vater des Schwiege rsohns nicht eingeladen worden, weil er falliert hatte. Ich bat um die Erlaubnis , ihn zu holen, weil ich sonst auch nicht bleiben wrde. Jedermann hatte dies mens chlich und edel gefunden, doch jetzt sprach man ber ein so khnes Betragen. Der Kunstpfeifer war einst ber Land gegangen, um auf einer Bauernhochzeit aufzuwa rten. Ich war eben bei der Frau, als ein Bauer eines andern Dorfes erschien und Tanzmusik forderte. Die Frau sagte, ihr Mann sei schon auf einer Hochzeit, sie kn ne daher keine Musik schaffen, worber der Bauer ganz untrstlich war und zuletzt sa gte: er msse Musik schaffen, und wenn solche fnfzig Thaler fr eine Nacht kosten sol lte. Ich entschlo mich, nahm einen Burschen, der im Hause war, und noch einen Bek annten mit, der Violine spielte. Es war nur noch eine schlechte Geige, eine alte Bageige und eine Trompete im Hause. Ich nahm meine italienische Violine, setzte mich mit meinen Genossen auf des Bauers Wagen, und wir spielten die ganze Nacht, ohne auszuruhn. Andern Tags baten die Bauern aufs freundlichste, wir mchten dies en Tag noch dableiben und ferner Musik machen; es geschah. Nachmittags kam der S tadtpfeifer mit allen seinen Leuten dazu, und nun [169] waren die Bauern ganz au sgelassen. Wir spielten noch eine Nacht, und der Kunstpfeifer erhielt von den Ba uern, was er forderte, da sie uns dann noch die Wagen mit Fleisch, Kuchen und Frc hten bepackten und uns so unter lautem Jubel nach der Stadt sandten. Diese Geschichte war anfangs als ein Zug von Liberalitt von Hause zu Hause erzhlt und vergrert worden; jetzt sprach man mit Wegwerfung von dem Geniewesen, welches a uf keinen grnen Zweig komme, sich gemein mache, und dergleichen. Der Kunstpfeifer wohnte auf dem Turme der Stadtkirche einundzwanzig Treppen hoch , wo ich fast tglich war. Sein Lehrbursche war verpflichtet, alle Stunden vom Tur me herab in ein kleines Horn zu stoen. Einst spielte ich mit dem Stadtpfeifer und diesem Burschen ein Trio von Graun. Ich hatte viele Takte zu pausieren, und die Glocke schlug, indem der Bursche spielte. Unterdessen sprang ich hinaus und sti e in der Geschwindigkeit wohl zwanzigmal hintereinander ins Horn. Der Kunstpfeife r kam gleich hergeschrien: Mein Gott, was machen Sie! Wo ist denn das Feuer? Genug , die ganze Stadt lief zusammen, und alles kam auf den Turm, um das Feuer zu seh n. Auch diese Geschichte wurde jetzt aufgewrmt und als eine unerlaubte fferei der gan zen Stadt wiedergekut. Obwohl nun ich merkte, da ich von meiner Liebe zu Jeanetten keinesweges geheilt w ar, und innig trauerte, wenn ich mir vorstellte, da wir jetzt schon auf unserer R eise nach Italien mten begriffen sein, so machte ich doch ernstliche Anstalten, mi ch dieser rgerlichen Leidenschaft zu entziehn, denn Jeanette hatte mir meine [170 ] Briefe zurckgeschickt und die ihrigen dagegen verlangt. Ich entschlo mich daher, nicht wieder nach Berlin zurck, und jetzt allein gerade nach Florenz zu gehn. Zu erst setzte ich einen Brief an meinen Vater auf, der folgendermaen lautete: Ewig geliebter Vater! Ich wei nicht, wie ich Ihnen alle [Wohltat und] Vatertreue genug danken soll, die Sie mir seit meiner Kindheit bewiesen haben; dadurch aber haben Sie mein Herz s o berschwenglich mit Vertrauen und Liebe gegen sich erfllt, da ich nun noch eine, n och die letzte Bitte wage. Ich habe schon lngst ein heies Verlangen gehabt, die Welt zu sehen, besonders Ital ien; ich wrde Sie eher gebeten haben, mir eine Reise zu erlauben, wenn nicht Ihre Anordnungen meinen Wnschen immer voran gewesen wren. Jetzt habe ich diesen Anordn
ungen gengt; ich bin geworden, wozu Sie mich haben machen wollen, und ich glaube fest, Sie verzeihen mir, wenn ich von hier sogleich weitergehe und mich einige J ahre in der weitern Welt umsehe, wie andere Menschen sind und andere Sitten. Daz u aber bedarf ich Ihres Beistandes so sehr als jemals. Auf das Handwerk kann ich als Meister nicht wohl reisen; mit den Gesellen zu arbeiten, knnte mir in Berlin bel ausgelegt werden. Daher bitte ich Sie kindlich und herzlich, lassen Sie sich noch diese Kosten nicht gereuen, mich auf meiner Reise zu unterhalten. Meine Mutter wird weinen, das wei ich, aber meine Auffhrung in fremden Landen und mein Wiedersehn nach der Entfernung wird sie trsten und[171] meine eingebrachten Kenntnisse und Erfahrungen werden ihre letzten Tage mit Freude bestreuen. Sie knnen mir diese Bitte nicht versagen, das wei ich, und daher gehe ich von hier sogleich ber Dresden und Prag nach Wien, von da aus ich Ihnen ganz gewi sogleich meine Ankunft melden werde, weil ich mich hier eine Zeitlang aufzuhalten gedenke . Dieser Brief war noch nicht geendigt, als mir mein Vater von Berlin schrieb, es tue ihm herzlich leid, mich in meiner angenehmen Ruhe zu stren, die er vor allen mir am liebsten gnne, aber er msse mich bitten, auf das schleunigste nach Berlin z u kommen, weil meine Mutter tdlich krank worden sei. Die Aussichten zu den Geschft en des knftigen Sommers lieen sich zugleich so vorteilhaft an, da er meine Hilfe br auche. Zugleich sicherte er mir die Hlfte seines Verdienstes als meinen rechtmigen Anteil an allen seinen Geschften zu, aber er bte nochmals, da ich sogleich kommen mchte. Als ich zurck nach Berlin kam, fand ich meine Mutter noch in Gefahr, aber es schi en, als wenn der Anblick ihres einzigen Sohnes den Tod vom Leben schied, denn ih re Besserung nahm schnell zu. Sie drckte mich aufs zrtlichste an ihr Herz, so oft sie mich sahe, und bat instndigst, sie und meinen Vater nicht wieder zu verlassen . Zuletzt erklrte sich denn die ganze Sache: Ich war unvorsichtig genug gewesen, dem Kunstpfeifer etwas von dem Vorhaben meiner Reise zu offenbaren, und dieser h atte es meiner Schwester gesagt. Meine Mutter hatte einen Traum gehabt: Sie stand am Ufer eines Sees bei Potsdam, der Schwielow genannt. Hier sahe sie auf einem leichten Fischerkahn mich [172] unter Wind und Wellen umhertreiben und zuletzt untersinken. Den Morgen darauf er hielt sie einen Brief von meiner Schwester, der ihr das Geheimnis meiner Reise v erriet; sie war schon unplich gewesen und fiel nun in die schwere Krankheit. Ich sah wohl ein, da mein Vater nicht allein fertig werden konnte. Er war ber sech zig Jahre alt und hatte sich eine Menge Arbeit auf den Hals geladen, indem er au f meinen Beistand gerechnet hatte. Er habe, sagte er, mir treulich beigestanden und hoffe, ich werde ihn jetzt nicht stecken lassen. So war meine Reise nun fr diesmal wieder unterbrochen, doch nicht aufgegeben, und da ich hoffte, diesen Sommer viel Geld zu verdienen, so war mein Plan, nachher desto sorgloser in Absicht des konomischen sein zu knnen. Meine Gewohnheit, frh bei der Hand zu sein, leistete mir ihre guten Dienste. Des Morgens war die Reihe an mir; ich richtete ein, ordnete an, nahm die weitesten Gnge auf mich, und mein Va ter bekam jugendliches Feuer. Meine Mutter besorgte mit gewohnter Geschftigkeit, was im Hause ntig war; gab heraus, schrieb auf, und so gingen die Sachen ihren gu ten Gang, doch je mehr wir arbeiteten, je tiefer fielen wir in die Arbeit hinein ; war eine Arbeit fertig, so waren unterdessen zwei oder drei neue vorhanden, un d es war nicht herauszukommen. Und darber kam das Jahr 1785 heran. Meine Mutter w urde hier vom Schlage getroffen, und dieser Schlag traf das ganze Haus, besonder s aber meinen lieben Vater, der sich an eine husliche Bequemlichkeit gewhnt hatte, die allein von meiner Mutter ausging.
Die Krankheit meiner Mutter zog sich in die Lnge, und meines Vaters Lebhaftigkeit nahm mehr und mehr [173] ab. Die Arbeit ward ihm lstig, das Haus voll Traurigkei t, und sein frisches, reines Gesicht bekam eine krnkelnde, gelbliche Farbe. Im Ja hre 1786 starb Friedrich der Groe. Auch dieser Todesfall ergriff ihn sichtbarlich . Mein Vater hatte den Knig persnlich gekannt. Schon als Gesell hatte er in Sansso uci an den Terrassen und Treibhusern gearbeitet, und der Knig hatte sich, fter mit ihm unterhalten. Einst fragte ihn der Knig, was er fr ein Landsmann sei. Ein Sachse! war die Antwort. Der Knig fragte weiter, was er von seinen Landsleuten halte. Er sah den Knig an u nd sagte: Halten sie viel auf uns, so wollen wir auch auf sie halten. Diese Antwor t schien dem Knige zu gefallen, welcher nun alle Tage zur Arbeit kam und sich die s und jenes erklren lie. Ich komponierte eine Trauermusik auf den Tod dieses Kniges und fhrte solche in der Garnisonkirche zum Besten der Frankfurter Leopoldsschule auf. Die Musik war nic ht ohne Sensation und mute noch einmal in einem Konzertsaale aufgefhrt werden. Mei n Vater sa neben dem Professor Engel, der mit ihm ber diese Musik sprach, und nach her mute ich meinem Vater die Haltung derselben selber erklren. Der Anfang derselben bestand in einer lugubren Intrade aus g-moll im 3/2-Takte. Das volle Orchester mit gedmpften Instrumenten uerte sich in tiefen, langsamen Schlg en, zwischen welchen eine Oboe und eine Flte in gezognen Klagetnen miteinander kon zertieren. Nachd er Ouvertre redete die Stimme eines Fremden den Chor an: woher d as Klaggetn eines Volkes, das, durch seinen Knig an Glckund Freude gewhnt, sonst nur Lieder der Wonne und des Wohlseins habe hren lassen? [174] Der Chor antwortet nun: eben dieser Held, der Groe Friedrich, sei nicht meh r. Die Einzelnen aus dem Chore unterhalten sich nun ferner ber seine Taten und se ine lange, beglckende Regierung, und zuletzt heit es, der Olymp habe den Helden au fgenommen und sein Andenken unter die Sterne gesetzt. Den Beschlu endlich macht d ie Anrufung an den Gotterhobnen, seine Nachfolger und sein Volk nicht mit seiner Weisheit zu verlassen. Mein Sohn!, sprach mein Vater zu mir, es wrde mich jetzt gereuen, Dich nicht Deiner Neigung zur Musik ganz berlassen zu haben, wenn sie sich frher gezeigt, wenn ich s ie frher gewut htte. Meine Absicht mit Dir war keine geringere, als einen bedeutend en und womglich den vermgendsten Mann aus Dir zu machen; dazu wollte ich, dazu kon nte ich Dir helfen, wenn Gott dazu seinen Segen und Dir das Talent verliehen htte . Alle Tonknstler, die ich kenne, haben mir abgeraten, Dich zu einem Tonknstler zu erziehn, und wenn ich ihre armseligen Umstnde betrachtete, so bestrkte sich die M einung in mir, da ein Handwerksmann berall besser daran ist als ein Musikus, der a lle Augenblicke um Brot seufzt, wenn nur der Tod eines groen Herrn, ein Krieg ode r sonst eine Staatsvernderung einfllt. Ich habe zum ersten Mal erfahren, was eine Musik wirken kann; ich gestehe es, De ine Musik hat mich bewegen mssen, da ich doppelten Anteil daran nehme, insofern e s Deine Arbeit ist und den groen Knig beklagt, den dies armselige Land lange genug zu beweinen haben wird. Ich kann sagen: ich freue mich, da ich alt bin und gesehn habe, was ich sahe, den n seinesgleichen werde ich [175] nicht wiedersehn. Ich bin nicht in diesem Lande geboren und erzogen; mein Auge war gewhnt an gesegnete Ernten, an Nahrung und Be trieb der Land-und Stdtebewohner; aber was eine kluge, geschftige Regierung kann, habe ich auf diesem drren Boden [gesehn], in einem von Natur magern, durch einen langen Krieg entvlkerten Lande gesehn. Das kleine Geschlecht hat den Helden geschmht, weil es ihm den Kaffee teuer bezah len mute; es wird ihn einst loben, wenn es Brot und Salz wird teuer bezahlen mssen . Dieser Kaffee, wie jedes unnatrliche Streben nach unheimischen Bedrfnissen, wird
die Fugen der Welt auseinanderreien, und man wird nicht klger sein, als man war. Ich kann nicht mit Worten sagen, wie mich der Tod des alten Kniges ans Herz geht; ich werde ihm bald nachfolgen und finde Trost in dem Gedanken, ihn vor mir zu w issen. Deine Mutter wird wahrscheinlich vor mir dahingehn, das wird mir den Rest geben; ich frchte mich, allein zu bleiben, darum bitte ich Dich, verla mich nicht in meinem Alter! Ich gestand ihm meine Neigung, nach Italien zu gehn, und die heimlichen Anstalte n, welche ich von Zeit zu Zeit dazu getroffen hatte; aber ich versprach ihm, sol ange er lebe, keinem Gedanken an eine Entfernung von ihm mehr Raum zu geben. Die s erheiterte und ermunterte ihn aufs hchste. Es war nach der Mittagsmahlzeit, und wir saen noch am Tische; er lie noch Wein bringen, und wir tranken zusammen und s tieen an auf die Genesung meiner Mutter und ewige Liebe und Treue. Endlich mute ic h ihm noch das Lied Nun danket alle Gott auf dem Flgel spielen, wozu er mit heller Stimme sang, indem seine Augen von Trnen glnzten. [176] Unser trefflicher Arzt, der Geheime Rat Selle kndigte uns endlich an, da das Hauptbel meiner Mutter sich hebe, und er hoffe, das gute Kleeblatt werde noch ei ne Weile beieinander bleiben knnen. In der Stadt wurden die grten Anstalten zur Huldigung des neuen Kniges getroffen. A lles war voll Freude und Wonne, und man sahe der neuen Regierung mit Hoffnungen und Aussichten, jedes nach seiner Art, entgegen. Friedrich der Groe war in den letzten Jahren als verdrielich, mitrauisch und, wie e inige wollten, geizig angesehn. Viele waren unzufrieden; die alten, geprften Einr ichtungen schienen das Leben und die Bewegung verloren zu haben. Man verlangte d ie Dinge nach einem gewissen neuen Geist der Zeit zugeschnitten, und alles dies wurde nun von der neuen Regierung erwartet. Auch Stamford, einer der geschicktesten Ingenieure des Knigs, gehrte zu den Unzufr iedenen. Er hatte ein geringes Gehalt, welches ihn an seiner Verbindung mit Mari en verhinderte, und da er nicht mehr hoffte, hier befrdert zu werden, hatte er ku rz vor dem Tode des Kniges seinen Abschied genommen und war in hollndische Dienste gegangen, wo er in kurzer Zeit General ward. [Mein Vater fand einen Beruf darinne, mich als einen jungen Brger zur Huldigung a nzufhren, welches sich indessen nicht tun lie, da er als Brgerkapitn paradieren mute. ] Die Huldigung des neuen Kniges war bestellt. Marie war mit ihrer Mutter von Potsd am gekommen, um der Huldigung beizuwohnen, und beide aen den Abend vor der Huldig ung bei meinen Eltern. [177] Es waren auf dem Schloplatze Tribnen und Logen fr Zuschauer aufgeschlagen. Ei ne solche Loge hatte ich bereits fr mich und Marien nebst der Mutter gemietet. Da es den Anschein hatte, da man sich am morgenden Tage bei guter Zeit wrde einfinde n mssen, um durch das Gedrnge zu kommen, so beschlo ich, diese Nacht in Mariens Hau se zuzubringen, welche in der G egend des Schlosses ihre Wohnung hatte. Man mute des Morgens um fnf Uhr bei der Hand sein. Die Friseurs waren so beschftigt , da Marie sich entschlossen hatte, angekleidet zu bleiben, um der Sorge fr ihren Kopfputz berhoben zu sein. Die Betten der Mutter und Tochter standen in einem Zimmer. Die Mutter und Grete legten sich nieder. Da kein Sofa vorhanden war, bereitete Marie aus ihrem Bette ein Sofa; die Decke wurde gegen die Wand gelegt. Hier lieen wir uns nebeneinander nieder und lasen wechselsweis Shakespeares Kaufmann von Venedig vor. Die Mutter w ollte nicht schlafen und hrte anfnglich aufmerksam zu. Die Nacht war khl. Nach und nach ward die Decke herumgezogen. Man wurde mde; erst lehnte man sich auf die Sei
te, dann legte man sich bequemer, und die bestimmte Stunde ward glcklich von uns allen verschlafen. Nach sieben Uhr erwachte die Mutter zuerst, sprang aus dem Be tt und erhob ein furchtbares Spektakel, da sie uns nebeneinander ordentlich im B ette liegen und schlafen sah. Grete erschien auch und rieb sich die Augen, aber die Mutter war in Verzweiflung und sprach von entsetzlichen Dingen, die unter ih ren Augen geschehn sei[e]n. Marie lachte, was sie konnte, als sie zu sich gekomm en war; doch die Mutter war nicht zu beruhigen. Sie nannte ihre Tochter ein[178] Mensch, ein Nickel, und je mehr sie lsterte, je toller lachte Marie. Indessen war es die hchste Zeit, nach unserer Loge zu gehn, welches anfangs die M utter gar nicht zugeben wollte und endlich auch selber nicht mitging, sondern im merfort schimpfte, bis wir zur Tre hinaus waren. Sie schickte auch die Grete nach , doch diese ward zurckegewiesen, und sie zerstreuete sich unter der Menge. Eichners waren diesen Mittag zu meinen Eltern gebeten. Nach der Huldigung fhrte i ch Marie zu uns und dann nahm ich einen Wagen, um die Mutter zu holen, welche er st gar nicht von der Stelle wollte. Als ich ihr aber auf Ehre und Pflicht versic herte, wie alles zugegangen sei, beruhigte sie sich und fuhr mit mir, indem sie sagte, dieses Mal wolle sie mir einstweilen glauben, aber sie wrde von nun an bes ser auf der Hut sein. Marie konnte sich nicht enthalten, die ganze Geschichte bei Tische meinem Vater zu erzhlen, der darber sehr lachte; nur meine Mutter wollte nicht lachen und nahm die Partei von Mariens Mutter ernsthaft. brigens kam mir selber die Sache sonderb ar genug vor, eine ganze Nacht neben dem liebenswrdigsten weiblichen Geschpfe im B ette zu liegen. Auch Grete konnte sich der Anmerkung nicht enthalten, was der Ha uptmann dazu wrde gesagt haben, und erhielt dafr von Marien eine derbe Ohrfeige. Einige Tage darauf wollte meine Mutter von mir wissen, ob ich gesonnen sei, Mari en zu heiraten. Da ich sie aber versicherte, da das Mdchen mit dem Hauptmanne so g ut als verlobt sei, war ihre Neugierde befriedigt, und sie nahm nun Gelegenheit, mich zu erinnern, da ich jetzt auf eine anstndige Heirat zu denken habe. [179] Meinem Vater gefiel Marie sehr. Ihr frisches, lebendiges Wesen und die rei ne deutsche Luft, mit der ihr alles aus dem Herzen ging, hatte ihn ganz gewonnen . Zu einer Heirat hatte ich indessen jetzt weniger Luft wie jemals, ob ich gleic h das Reisen vor der Hand ganz aufgegeben hatte. Als ich das nchste Mal nach Potsdam kam, sagte mir Marie, sie sei diesen Abend zu Hofpredigers gebeten und habe den Auftrag, mich mitzubringen. Ich fand daselbst eine zahlreiche Gesellschaft, die sich jedoch fast durchaus mit dem Kartenspiel belustigte. Die einzige Tochter Lucie und noch einige junge Leute unterhielten sich redend. Lucie war ein angenehmes Mdchen, klein und schwach von Person, und h atte etwas Hngendes, Schwrmerisches in Wesen und Stimme. Als wir zu Hause gingen, fragte mich Marie, wie mir dies Haus gefalle. Ich wute selber nicht, was ich glei Nun, so kann ich Ihnen die Versicher ch antworten sollte und sagte daher: sehr gut! ung geben, sagte sie, da auch Sie recht sehr gefallen haben. Marie wute es einzurichten, da ich alle Tage mit dem guten Mdchen zusammen war, und da ich endlich gar nicht merkte, was sie im Schilde fhrte, trat sie mit deutlich en Worten heraus, da ich diese Lucie, der ich ganz wohl gefalle, zur Frau nehmen solle. Einer von unsern Bekannten, ein Hauptmann vom Geniekorps, von dem ich wute, da er viel um das Mdchen gewesen war und seit Jahr und Tag mit ihr geliebelt hatte, war seit einiger Zeit seltener geworden und jetzt im Begriff, eine reiche adelige W itwe zu heiraten, und nun war Lucie freilich wieder zu haben. Ich war einer sehr heitern Stimmung, als Marie dieses[180] vortrug, und sagte darauf, ich wolle mi ch bedenken und ihr Antwort sagen. Nach einiger Zeit fragte Marie, was ich denn in Absicht auf Lucien beschlossen htte. Ich antwortete ganz treuherzig, sie werde
wohl einsehn, da ich fr Lucien kein Mann sei; aber einer unserer Bekannten sei ei ne ebenso heimliche, zrtliche Natur als sie, und ich hielte es fr mglich, da diese b eiden Leute ganz glcklich miteinander leben knnten. Marie lachte, was sie konnte, doch mein Vorschlag erfllte sich. Die beiden Leute sahen und gefielen einander, u nd in kurzem waren sie ehelich verbunden. Es war im Dezember des Jahres 1786, als ich eines Tages zu Mariens Mutter gerufe n ward. Ich fand sie allein, in Trnen und von heftiger Leidenschaft bewegt. Sie s agte mir, es sei gestern ein Brief aus Amsterdam von Stamford angekommen, worin dieser um die Hand ihrer Tochter anhielte; ehe sie dies jemals zugeben werde, wo lle sie sie lieber sterben sehen. Sie fuhr hier fort, sich in Beleidigungen ber d en Mann zu ergieen, die ich allerdings anhren mute, wenn ich Stamford ntzlich sein w ollte. Ich fragte nach Marien, und was diese dazu sage. Sie habe sie, war die An twort, ausgeschickt; auch sie stecke in dem Komplott, sowie Grete, Lucie und wer sonst noch. Ich verhehlte ihr nicht, da ich um die Sache wisse und darin nichts Unrechtes fnde . Stamford kenne Marien seit ihrem achten Jahre, und sein Einflu auf ihre Erziehu ng sei so unverkennbar, da ich glaube, wenn Marie selbst zu seinen Wnschen stimme, so lasse sich nichts Gerechtes dagegen einwenden, es mte denn der Unterschied der Religionen sein, den sie, wie ich wohl denken knne, dabei fr wichtig halte. [181] Was reden Sie da fr Dinge! sagte sie. Ich bin eine gute katholische Christin, und meine Tochter habe ich auch dazu erzogen. Knnen Sie aber wohl sagen, ich htte Sie weniger gern gesehn, weil ich wei, welch ein eingefleischter Protestant Sie s ind? War nicht mein verstorbener Mann auch ein Protestant, ehe ich ihn heiratete ? Und ob er sich gleich um meinetwillen katholisch machte, so habe ich ihn gelie bt, ehe er es tat. Nein, das ist es nicht! Aber er gefllt mir sonst nicht, und je tzt ha' ich ihn um so mehr, da er uns jahrelang betrogen hat. Was ist denn aber, sagte ich, hier zu betrgen? Er liebt Ihre Tochter wie ein Ehrenma nn; er ist jetzt General und verlangt sie jetzt zu seiner Gattin. Ich wte nichts E hrenvolleres in der Welt, als die Frau und Mutter eines trefflichen Generals zu sein. Hren Sie, sprach sie, Sie sind kein General und kein Katholik; Sie lieben meine Tochter, das wei ich. Halten Sie um sie an! Hier ist meine Hand, Sie sollen sie haben mit der Bedingung, wenn sie wollen die Kinder katholisch erziehn lassen. Ich hatte einen unmigen Schreck ber diesen Antrag und konnte in diesem Augenblick k eine Antwort finden; ja, ich geriet so in Verwirrung, da ich zitterte und mich se tzen mute. Sehen Sie wohl, sagte sie, da ich den rechten Fleck getroffen habe? Sie lieben sie, und Ihnen kann ich sie gnnen; Sie sind ein blhender, junger Mann, und er ein abgel ebter, vierzigjhriger Wstling. Was soll aus einem Menschen werden, der von der Hyp ochondrie halb aufgefressen ist und seit zwei Jahren die Kaempfsche Kur brauchen mu, um nur nicht unausstehlich zu sein? Ich suchte eine schickliche Gelegenheit, mich zu entfernen, [182] um nur an die Luft zu kommen, denn ich wre des Todes gew esen, wenn jetzt Marie hereingetreten wre. So empfahl ich mich. Meine Fe trugen mich zum Tore hinaus, und ich ging in stummem Brten eine groe Streck e in den Wald hinein. Mein erster Gedanke war Stamford, den ich seit drei Jahren sehr lieb gewonnen hatte. Sollte er aber, berlegte ich mir, Marien wohl glcklich machen? Er konnte ein Mann gegen vierzig sein und in jngern Jahren viel gelebt ha ben; er war oft krnklich und in hohem Grade hypochondrisch. Marie konnte halb so alt sein; wie lange sollte diese Freude whren? Marie selbst hatte mir niemals eig entlich verliebt in ihn geschienen, und es traten Momente vor meine Erinnerung, aus denen ich mich fr begnstigt halten konnte. Wenn ich mit Stamford stritt, hatte sie mir oft Recht zuerkannt; wenn sie mit ihm stritt, forderte sie mich auf, ih re Behauptungen zu besttigen. Marie hatte von Natur eine ungemein sanfte Touche, das Fortepiano zu behandeln, welches sie wirklich schn spielte, und Stamford beha
uptete einst, er wolle mit den bloen Ohren ihr Spiel von jedem andern und auch [v on] dem meinigen zu unterscheiden wissen; die Mutter war seiner Meinung. Dies wa r natrlich: ich hatte von Jugend auf Klaviere, Flgel und Orgeln unter den Fingern gehabt, und schon von Natur war meine Art krftiger, ja herber. Mir kam indessen d ie Luft an, eine Probe zu wagen, und Marie stimmte mit groer Luft ein. Aber es so llte eine Wette gelten: die Verlierer sollten ein Souper geben, und die Gewinner die Gste bitten. Stamford und die Mutter stellten sich hinter einen Schirm. Ich spielte zuerst eine von Mariens Sonaten nach der Art, wie sie zu spielen [183] p flegte, und nun setzte sich Marie ans Instrument und spielte eine meiner Komposi tionen so nach meiner Art, mit allen Zeichen meines Wesens, da Stamford und die M utter die Wette verloren und ein Souper gaben, wobei Marie und ich liebe Gste bat en und uns allen ein sehr vergngter Abend ward. Bei Tische kam einst das Gesprch aufs Fechten. Ich sagte, da ich in frhern Jahren g ern gefochten htte, und Stamford schlug vor, nach Tische es mit mir zu versuchen. Grete mute fort und Rapiere holen. Die Mutter war unpa und lag im Bette. Nach der Mahlzeit kamen die Rapiere. Wir zogen die Rcke aus, gingen auf den Hausflur, und Marie, die mitging, sagte, wer sich am besten hielte, den werde sie nach Ritter sitte beschenken. Nach einigen Gngen stie Stamford gegen den Schild meines Rapiers; der Knopf sprang ab, und da ich vergessen hatte, meine weiten Hemdrmel zu binden, fuhr die Spitze in meinen rechten Arm und hatte etwas gefleischt, da das Blut sichtbar wurde. Marie trat sogleich dazwischen und sagte, sie sehe Blut. Sie streifte mir den Ar m auf, nahm etwas Balsam aus einem sammetnen Besteck, und mit leichtfertigen Zer emonien wusch und verband sie die Wunde; dann holte sie eine Nhnadel mit roter Se ide und umnhte den Ri in meinem Hemdrmel. Stamford, dem die Komdie zu lang whrte, schien belzunehmen und ging aus dem Hause. Als er zum Abendessen wiederkam, hatte sich Marie krank gemacht und ins Bett gel egt, weshalb wir allein essen muten. Da wir miteinander zu Hause gingen, klagte e r mir seinen Verdru und nannte ihr Betragen wunderlich; sie aber [184] lie nichts weiter merken, und am andern Tage beschenkte sie ihn mit einem artigen Etui und mich mit einer seidnen Brieftasche. Solcher Erinnerungen fanden sich in meinem Gedchtnisse eben mehrere an, und ich g estehe, da sich in mir die Neigung regte, Marien zu besitzen. Durch den Antrag de r Mutter fand ich mich aufs hchste geschmeichelt, und so trumte ich mich nach Haus e. Ich fand hier eine Karte, welche mich beim Professor Engel zum Abendessen einlud . Als ich zu Engel kam, trat er zu mir und sagte, er werde gegen meine Meinung s ein, ich solle mich tchtig wehren. Eichners fand ich hier allein, und es whrete ni cht lange, so kam das Gesprch auf die Heirat. Marie war still und sprach kein Wor t. Die Mutter tobte und lsterte in einem fort. Engel gab so zu, als ob er ihrer M einung sei. Dies gab jener Mut, und da Marie immerfort schwieg, hielte ich es fr Zeit, Stamfords Recht zu vertreten, indem ich meine Argumente gegen Engel richte te. Wir wurden beide im Ernst eifrig gegeneinander, man trank dazwischen verhltni smig Wein, es ward spt in der Nacht, und auer Marien waren wir alle so illuminiert, da uns das Aufstehen sauer ward. Marie sa wie ein Friedensengel zwischen uns; ihre natrliche Heiterkeit, ihr leichtes Blut und dann und wann ein Blick des Mitleids auf ihre Mutter und deren Vorsprecher erhheten ihre Liebenswrdigkeit so sehr, da i ch in diesem Augenblicke meines Herzens Blut fr sie htte flieen sehn. Am andern Morgen wollte ich zu ihr gehn. Sie trat eben aus ihrer Haustr, um eine Freundin zu besuchen. Ich ging mit ihr. Nun, sagte sie, wie ich vernehme, hat geste rn frh meine Mutter Auktion ber mich gehalten. [185] Wieviel haben Sie denn gebote Ich erzhlte ihr den gestrigen Antrag i n? So erfahre ich einmal, was ich wert bin! hrer Mutter, worber sie ganz erstaunt war, denn so wute sie es noch nicht. Ich habe,
versetzte sie, niemals mehr auf die Mnner gehalten, als sie mir gefallen haben, a ber gestern abend habe ich gesehn, wie gut das Andenken eines Mannes unter Mnnern aufgehoben ist. Streitet Ihr auch untereinander ber mich so viel als Ihr Lust ha bt; am Ende werde ich tun, was ich fr recht achte. Wenn ich Stamford nie geliebt, ja wenn ich ihn nicht gekannt htte, so htte er mir gestern wert werden mssen! Und wozu sind denn Sie nun entschlossen, da Sie mich im Sacke haben? Was wollen Sie meiner Mutter antworten, wenn Sie es noch nicht getan haben? Ihre Mutter, sagte ich spahaft, wird so gut sein, mir den Antrag noch einmal bei klterm Blute zu machen. Dann werde ich zuschlagen und die ganze Welt auslachen, das verstndigste, liebens wrdigste Mdchen in meine Arme zu schlieen. Im Jahre 1787 starb mein Vater fast pltzlich, denn am neuen Jahrstage ging er noc h in die Kirche und am 25. desselbigen Monats war er tot. Ich hielt mich gefat genug, den groen Verlust zu ertragen, und wollte eine Musik a uf seinen Tod machen, doch ich sahe bald die Unmglichkeit des Unternehmens ein. E igentlich hatte ich erst zuletzt die Liebe meines Vaters recht innig gefhlt, inde m ich mir sein Leben neben meine Jugend zurcke rief. Der Schmerz der Seele lag in der Tiefe auf einem Punkt, und was ich niederschrieb, erschien dagegen nach auen kalt, ja unmelodisch. So wie ich zu der Musik auf den Tod des Kniges meine Total empfindung nur in musikalische Formen zerlegen [186] durfte, so war hier alles u nzerteilbar und der uerlichen Darstellung entgegen. Meine beiden ltern Schwestern waren lngst verheiratet, und so war ich nun mit mein er kranken Mutter ganz allein. Das schne Verhltnis war zerrissen, die alte Ordnung fehlte, und meine Ttigkeit war ohne Ruhe, indem ich tglich nun auch den Tod meine r Mutter erwarten mute. Da das Metier durch seinen Tod leiden wrde, sah ich sogleic h ein. Es war eine Luft, mit ihm zu arbeiten, weil ihm alles so leicht von der H and ging. Er wute genau, wie das fertige Haus jedesmal aussehn msse, und zeichnete mit freier Hand die besten Grundrisse. Bei seiner grndlichen Kenntnis des stdtisc hen Lokalwesens taxierte er die Kosten so genau, da er sich nur um weniges betrog . Als ich den Anschlag zu meiner Meisterzeichnung machte, welche letztere er ebe n gesehn hatte, sagte ich ihm eines Tages, indem wir uns zum Mittagsessen nieder setzten, da das Maurerarbeitslohn hart an vierzigtausend Thaler betrage; er sagte darauf nichts und war beim Essen immer in tiefen Gedanken. Endlich stand er auf und rief aus: Das ist ganz unmglich! Das Arbeitslohn mu gegen fnfzigtausend Thaler betragen! Du hast Dich sicherlich verrechnet. Ich rechnete die Hauptartikel einze ln noch einmal und fand sie richtig; aber im Summieren hatte ich's versehn, und die ganze Summe betrug wirklich siebenundvierzigtausendneunhundertundfnfunddreiig Thaler. Ungeachtet seiner groen und heitern Ttigkeit war er beim Handwerke nicht reich wor den: er bauete mit Luft und hielt seine Leute sehr gut. Wenn er auf die Arbeit k am und zufrieden sein konnte, beschenkte er die Leute reichlich. [187] Er war gewohnt, die Schablonen der uern Zierraten aus freier Hand aufzuzeich nen. Bei einem grern herrschaftlichen Hause, das er baute, wollte er dies nicht wa gen und zeichnete ein ionisches Hauptgesims nach Ma und Modul auf. Das Gesims war gemauert und gezogen, als er auf den Bau kam; es mifiel ihm jedoch so sehr, da er sogleich die Schablone aus freier Hand verbesserte und befahl, das fertige Gesi ms herabzubrechen und nach der neuen Schablone zu mauern. Die smtlichen Leute bat en ihn, dies nicht zu tun, denn die Arbeit war sauber gemacht; doch er lie sich n icht erweichen. Als er aber wiederkam und das neue Gesims sahe, war er auer sich vor Freuden und beschenkte die Leute auf das reichlichste ber ihre schne Arbeit. Am 6. April 1787 trat Grete wie eine Verzweifelnde in mein Zimmer, und mit dem G eschrei unertrglicher Schmerzen erschreckte sie mich mit der Nachricht von Marien s Tode. Sie ist ermordet! rief sie aus. Man hat sie umgebracht! Ich habe es vorher gesagt! Man hat nicht hren wollen! Auch Sie sind schuld an ihrem Tode! Alle Wunden meines Herzens ffneten sich hier zumal. Ich war ganz verlassen und brauchte viel
e Wochen, mich wieder anzufinden. Niemand konnte oder wollte mir etwas Zuverlssig es ber Mariens Tod sagen, weil viele sich dadurch gekrnkt fanden, und Grete, die s ich wie eine Mnade gebrdete und sich das Fleisch mit den Ngeln zerri, sobald ich sie fragte, wute nicht alles. Stamford hatte einen kostbaren Ring aus Dem Haag geschickt. ber diesen Ring war e ine unwrdige Szene zwischen Mutter und Tochter vorgegangen. Marie litt eben an ei ner weiblichen Unplichkeit und ward gefhrlich [188] krank. Man wandte sich zu spt an einen jungen Arzt, und am neunten Tage verlor ich meine se Freundin, nach deren A bscheiden Grete sogleich heimlich von Potsdam weggelaufen war, um mich mit der N achricht ihres Todes zu erschrecken. Ich brauche nicht zu wiederholen, welch ein himmlisches Bild des angenehmsten Frh lings diese Maria war; aber sie war auch eine sehr ausgezeichnete Sngerin. In der Kniglichen Opera seria, wo sie die zweiten Rollen der Graunschen, Hassesch en und Agricolaschen Kompositionen singen mute, war sie nicht an ihrer Stelle, wi e sie sich denn berhaupt wenige Mhe gab, pathetisch zu erscheinen. Die Werke diese r Komponisten wurden dazumal nur noch in Berlin gehrt. In Italien und Oberdeutsch land waren neuere Meister aufgetreten. Der Knig besuchte die Oper nicht mehr in P erson und schien sie blo der alten Ordnung wegen beizubehalten. Ich habe schon ge sagt, mit welchem Widerwillen der Knig gegen deutsche Theatersubjekte eingenommen war, welcher sich jedoch seit der Erscheinung der Mademoiselle Schmeling (nachh erigen Madame Mara), welche im Jahre 1771 angenommen ward, gemildert hatte. Da e s in Italien selbst an bedeutenden Sngerinnen zu fehlen schien, so war der Knig, w enn er die Oper nicht wollte aussterben lassen, gentiget, noch die Mademoiselle K och (nachher Madame Verona) und dann auch diese Eichner passieren zu lassen. Maria war in Mannheim von einem bejahrten italienischen Kastraten aus guter Schu le unterrichtet worden. Ihre Stimme war vom ungestrichnen f durch drei Oktaven r ein, gleich und in groen Schwierigkeiten gebt. Sie sang die chromatische Tonleiter hintereinander [189] auf und ab in ziemlicher Geschwindigkeit. Die sogenannte C atena di trilli hatte sie so in ihrer Gewalt, da in einem nicht zu kleinen Raume die Tne wie Nachtigallengesang schmetterten. Das Granito ihrer Passagen war erwec kend, ich mchte sagen: rhrend zugleich, und in der Messa di voce war sie eine Meis terin. Der berhmte Violinist Giornowicchi hrte mit dem innigsten Vergngen seine Vio linkonzerte von ihr singen und behauptete, vieles von ihr angenommen zu haben. A uf einem kleinen englischen Fortepiano von Buntebart spielte sie so schn, als man es nur hren kann, und wenn sie an Fertigkeit in Schwierigkeiten bertroffen wurde, so war dies doch an Anmut und Gleichheit des Vortrages nicht mglich. Die ausgesuchten Freuden, welche ich in dem Umgange mit dieser angenehmsten Mari a genossen habe, bewegen mich, ihrer mit Dank und Liebe zu gedenken; sie war ein Engel in Menschengestalt. Meine Mutter drang darauf, mich noch bei ihrem Leben zu verheiraten. Da sie selb st nicht von der Stelle konnte und sehn mute, da alles im Hause verkehrt einhergin g, konnte ich ihren Wunsch nicht tadeln, ob ich gleich nicht den geringsten Trie b fhlte, neue Bekanntschaften zu machen. Ich warf mich wieder mit Eifer in die Musik. Die Einsamkeit langer Abende und frh er Morgenstunden regte in meiner angegriffnen Seele musikalische Ideen auf, die jedoch selten zur Reise kamen, weil durch die Sorge um meine kranke Mutter und d en Betrieb der Geschfte die schnsten Stunden unterbrochen wurden. Ich bemhete mich um ein gutes Gedicht zu einer ernsthaften Oper, es war keines zu finden, und [190] begngte mich unterdessen, gefllige Szenen aus den Opern und Ora torien des Metastasio in Musik zu setzen. Doch hatte ich nun nicht einmal jemand en, der diese Stcke sang.
Hier erinnerte ich mich eines Mdchens, deren Brder ich im Gymnasio gekannt hatte. Der eine Bruder, welcher mit mir in einer Klasse sa, hatte mich fter mitgenommen i n das Haus seiner Eltern, und ich hatte bald bemerkt, da die jngste Schwester name ns Julie einen sehr angenehmen Sopran sang. Auch bei Jeanetten hatte ich sie nac hmals singen hren und das ganz besonders Natrliche und die Wahrheit ihres Vortrage s bewundert. Ihr Vater, ein sehr geschtzter Geheimer Finanzrat Friedrichs des Groen, war gestor ben; die Mutter lebte von einer kleinen Pension, und Julie war jetzt bei ihrer S chwester, der Witwe des Generalchirurgus Voitus, der neben Selle auch unser Arzt gewesen und sieben Tage nach meines Vaters Tode gestorben war. Diese Julie nun war es, welche mir fr meine Szenen geschickt schien. Ich fand bald Gelegenheit, nh er an sie zu gelangen, indem ich ihre Schwester besuchte, welcher ich das Honora r fr die Kur meines Vaters brachte. Mit Julien ward ich bald einig. Ich ging von Zeit zu Zeit zu ihr, und da es ihr nicht an Intelligenz fehlte, sich in den Ideengang jedes Komponisten gleichsam z u verweben, weil sie von schner Gemtsart war, so war sie mir die liebste, der ich meine Intentionen ber Ausdruck und Art mitteilen mochte, dagegen ich denn von ihr den ruhigen, tiefen Sinn lernte, der weder deckt noch schreckt, indem er rhrt un d bildet. Um diese Zeit bauete ich in meiner Strae ein Haus [191] fr eine junge Kaufmannswit we, deren Mann namens Flricke eben gestorben war. Sie hatte drei angenehme Kinder . Das jngste war ein dreijhriger Sohn von unendlicher Schnheit und Anmut der Gliedm aen. An dem Tage, da der Grundstein zum Hause gelegt wurde, gab die Witwe eine Abendm ahlzeit, wozu ich eingeladen war. Das natrliche, angenehme Wesen der jungen Frau gefiel mir um so mehr, da die Gemeinheit der brigen Gesellschaft, welche gleichwo hl aus guten Leuten bestand, mir desto langweiliger war. Ich lie mich daher auch nicht weiter im Hause sehn, als wenn es mein Geschft erforderte. Das Pfingstfest war gekommen, und meine Witwe lud mich ein, mit ihr zu ihren Elt ern zu reisen und diese Tage dort zuzubringen, welches ich gern tat. Ehe wir von hier abfuhren, bemerkte ich erst, da drei von der Abendgesellschaft a m Grundsteinfeste mit aufsteigen wollten, und war darber ganz verdrielich. Ein ltli cher langer, hagrer Uhrgehusemacher war der ertrglichste, weil er wenig sprach und fast bestndig schlief. Sonst war dieser gute Mann die eigenste Figur, welche ich gesehn habe: sein langer Krper sah aus wie ein Bndel senkrecht aufgestellter Latt en; kaum eine Ecke, eine Muskel stand hervor. Dabei hatte er ein kreideweies Gesi cht, trug eine Percke von der nmlichen Farbe, einen gelbgrnen Rock, lederne Beinkle ider und schwarze wollne Strmpfe. Der andere Reisegefhrte war ein junger Baukonduk teur und plauderte unaufhaltsam fades Gewsch, und selbst wenn er schwieg, war ich in Sorge, weil er bestndig den Mund offen hielt. Die dritte Person war eine Kusi ne, welche das Gesprch auf zrtliche Lektre zu lenken sich bemhte. [192] Wir fuhren bei trockenem Wetter ab, doch nach einer halben Stunde kam ein dichter, anhaltender Regen, der uns auf dem offnen Wagen bis auf die Haut durchnte . Die Frauenzimmer hatten Schirme, von denen das Wasser stromweise in meine Stie fel und Beinkleider troff. Ich war fast toll vor Verdru, soviel Ungemach zugleich erdulden zu mssen, ohne ausweichen zu knnen. Endlich waren fnf Meilen zurckgelegt, und wir waren an dem Orte unserer Bestimmung. Der Vater meiner Witwe war ein Kniglicher Frster. Er und seine Frau entsprachen vo llkommen dem Bilde, was nachher Iffland so wahr und lebendig von seiner Jgerfamil ie gegeben hat. Wir wurden sehr freundlich und herzlich aufgenommen, und da ich in allen Zimmern
Kamine gesehn hatte, war meine erste Bitte, mir ein solches Kaminzimmer fr mich allein zuzugestehn, welches mir meine Witwe sogleich bei ihrer Mutter auswirkte; wodurch ich denn zufrieden und aufgeweckt wurde, denn nun konnte ich doch auswe ichen. Beim Abendessen war man sehr munter. Der alte Frster hatte sich zu uns an den Tis ch gesetzt, obgleich er abends nicht a, und hrte lange genug das Geschwtz des Kondu kteurs an. Es ist billig, sagte er zu ihm, da Sie einmal in Ruhe zum Essen kommen. U nterdessen mgen die andern reden, die bis daher geschwiegen haben. Und nun fragte er allerlei ber den Fortgang des Hausbaues seiner Tochter, worber ich ihn denn bef riedigte. Nach dem fruchtbaren Regen war ein herrlicher Morgen aufgegangen, und da mir es in der Gesellschaft nicht gefallen konnte, machte ich mich an die artigen drei [ 193] Kinder meiner Witwe, die vor dem Hause im Grase spielten, und trieb mit die sen allerlei Possen, wodurch denn die Mutter herbeigelockt wurde. Ich kannte eigentlich diese Frau noch gar nicht, weil ich sie zu wenig gesehn ha tte. Sie hatte das angenehmste ^uere: ein wirklich schnes, geistreiches Gesicht, e ine reine, leichte Sprache, gefllige Haltung und Bewegung der Gliedmaen und ruhige Weiblichkeit. Von der allgemeinen Bildung der hhern Stnde mochte wenig in sie ein gedrungen sein; weder hoch noch gemein, noch scharf noch matt, schienen alle ihr e Fakultten ein einziges ruhiges Element zu sein. Ich war bald mit ihr in angeneh men Gesprchen begriffen. Sie hrte aufmerksam und antwortete so natrlich und sicher, da ich ihr bald sagen mute, mit ihr wrde ich lieber eine Reise um die Welt machen als mit den andern, so lange ich lebte, eine Spazierfahrt von fnf Meilen. Sie sag te darauf, der lange Mann sei ein alter, geflliger Freund ihres Vaters, der alle Sommer einige Mal seinen Besuch abstatte und die Hausuhren herstelle; der Konduk teur sei eigentlich die Ursache dieser Reise; er habe den Vater um die Erlaubnis gebeten, das Pfingstfest hier zu verleben, deshalb seien die Pferde geschickt w orden. Die Kusine sei ein gutes Mdchen, das ihr in der Krankheit und nach dem Tod e des Mannes treu beigestanden habe. Seitdem komme sie oft, nhme vorlieb mit dem, was sie fnde, und lasse sich berhaupt vieles gefallen. Die Kinder hatten sich bald so an mich gewhnt, da sie mir berall nachliefen, und da ich auch am liebsten mit ihnen im Freien war, so konnte ich eben nicht ber Lange weile klagen. Inzwischen hatte ich einen Boten nach Berlin gesandt, der meine ei genen Pferde mit einer [194] Chaise herbestellte; meine Witwe hatte darinne eine n Platz angenommen, und die Kinder freuten sich sehr, mit dem groen Vetter zu fah ren. Desto bequemer fuhren nun die andern auf ihrem offenen Wagen, denn nun konn te sich der Kondukteur mit der Kusine recht ausplaudern und der Lattenmann sich satt schlafen, ohne da es mich verdrieen durfte. Der Frster empfahl mir seine liebs te Tochter auf Rat und Tat, und so schieden wir auseinander. Der andere Wagen fu hr voran, und ich mit meiner Witwe anfnglich so sacht hinterdrein, da wir uns nich t einander hinderlich zu sein brauchten. Von meiner Witwe erfuhr ich nun, da beide Herren ein paar Freier waren und ohne g egenseitiges Wissen beim Vater um sie angehalten hatten. Der Vater aber habe jed em gesagt, da er ber seine Tochter nicht mehr disponieren knne, da solche selber Ki nder habe, und er erwarte hchstens, da sie bei einem so wichtigen Schritte ihren V ater zu Rate ziehe. Was meinen Sie nun, fuhr sie fort, welchen von den beiden Herre n soll ich akzeptieren? Ich bin fnfundzwanzig Jahre alt, deshalb ist mir der Kond ukteur offenbar zu jung, und der andere knnte mein Grovater sein; dem also bin ich zu jung. Sie sind ein kluger Mann, Sie haben meinem Vater versprochen, mich mit Rat und Tat zu untersttzen; beides brauch' ich jetzt; und nicht wahr, Sie werden Wort halten? Die Sache war allerdings sonderbar genug: zwei Freier hielten um die Braut an, u nd diese um die nmliche Zeit fuhr mit einem dritten davon. Ich leugne nicht, da si ch meine ganze Schelmerei hier regte. Der Alte hatte verheiratete unzufriedene K
inder, und der Kondukteur war ein unbrauchbarer Mensch; beide waren [195] arm, u nd an eine Freude fr dies gute Weib war nicht zu denken. Ich sagte daher der Witw e, fr diesmal knne sie meines Rates enthoben sein, da aus ihrer Frage vollkommen h ervorginge, fr welchen sie sich entschieden habe. Was habe ich gesagt? fuhr sie sch nell auf; ich bin fr keinen entschieden. Ich wnsche nicht mehr zu heiraten! ber dies Thema, das Stoff genug zur Unterhaltung enthielt, waren wir schnell genu g in Berlin angelangt. Die andern waren schon vorher angekommen und hatten sich sehr unzufrieden ber mich bezeigt und gesagt, der herrschaftliche Wagen werde bal d nachkommen, die Leute sollten nur gut aufpassen; und so waren sie in vollem Un mute jeder seinen Weg gegangen. Meine Mutter fand ich sehr krank und fast sprachlos; sie erkannte mich kaum und erwartete den Tod. Nach einigen Tagen erholte sie sich jedoch wieder. Meiner Witwe Haus ward nun gerichtet, und ein Abendschmaus krnte auch diese Feier lichkeit, welcher die nmlichen Gste beiwohnten. Unterdessen war allerlei vorgefall en: der Kondukteur hatte seit Pfingsten tglich seinen Morgenbesuch abgestattet un d sich mit einem Frhstcke bewirten lassen; gegen Abend kam der lange Mann, rauchte seine Pfeife Tabak, a und schlief nachher, bis er zu Hause ging; die Kusine, ind em sie sich des Hauswesens annahm, war oft wochenlang dort, und oft nahmen alle drei das Mittagsmahl dort ein, soda das gute Weib tglich drei ungebetene Gste zu er nhren hatte, die hchstens sich selber die Zeit vertrieben. Ich hatte mich wenig ge zeigt, weil ich den Jammer nicht sehn konnte und zum Lachen gar zu wenig aufgele gt war. Unterdessen hatten alle drei Zeit genug, eine Mine [196] gegen mich anzu legen, die mir wenigstens Schaden bringen sollte: An dem Bau war ihnen alles nic ht recht, und jeder mkelte nach seiner Art; besonders war alles zu kostbar, zu st ark und zu hoch. Auer dem Vorderhause sollte noch ein Seitengebude, eine Remise un d ein Pferdestall gebaut werden. Der Kondukteur hatte dazu Risse und Anschlge gem acht, die unter meinen Preisen und gegen meine Einsicht waren, und unter der Han d mit Zuziehung des Vormundes der Kinder bereits einen andern im Sinne, der dies bauen sollte. An einem Sonntage kam der erste Diener meiner Witwe zu mir, welch es ein junger, wohlgebildeter Mann war, mich hiervon zu unterrichten. Erst sagte er mir allerlei Schmeichelhaftes ber die Anlage des Hauses, von der er behauptet e, sie sei die beste fr einen Kaufmann; er habe sich schon ausgedacht, wie alles stehn und eingerichtet werden solle, doch mte er die schne, gute Frau bedauern, ind em ihre tglichen Gste einen guten Teil dessen verzehrten, was verdient wrde. Die Ku sine hole aus dem Laden, was sie brauche, und schicke es zu ihrer Mutter, und di e andern beiden Herren brchten noch Gste mit, und alle Tage ginge mehr drauf. Ich riet ihm, dieses seiner Prinzipalin zu sagen; es sei dies eigentlich sein Amt, u nd sie wrde [es] ihm gewilich Dank wissen. Er sagte, sie wisse es; sie habe auch s chon mit ihm aus freien Stcken davon gesprochen; doch sei sie nicht dreist genug, dem Leben ein Ende zu machen, und wenn dies nicht geschhe, knne nichts Gutes erfo lgen. Das Ende seines Vortrages bestand nun noch in der Bitte, sein Vorsprecher zu sein, weil er die schne Witwe zu heiraten gedenke, wo denn schon alles anders werden solle. Meine Mutter hatte jetzt einige heitere Tage, welche [197] ich benutzte und die Witwe bat, sie zu besuchen. Meine Mutter hatte ihre Freude an dem sanften Wesen der jungen Frau und sagte mir, solch' eine Schwiegertochter mchte sie wohl um sic h haben, und wenn nur diese nicht drei Kinder htte, so sei das Rechte fr sie und fr mich gefunden. Meine Witwe hatte jetzt Gelegenheit, ihren Freiern auszuweichen, indem sie abend s meine Mutter besuchte, die in ihr eine balsamische Gesellschaft fand. Wo diese junge Frau ihre Hand hinlegte, heilte alles; was sie angriff, ging vonstatten, und was sie anfing, war so gut als fertig, und ohne Gerusch. Einen Abend hatte der lange Lattenmann seinen Besuch wiederholt, und da er die W itwe nicht zu Hause fand, entschlo er sich, sie zu erwarten. Nach zehn Uhr bracht
e ich sie bis an ihr Haus und ging zurck. Hier erffnete er ihr sein Vorhaben, sie glcklich zu machen; bei ihrem Vater habe er schon um sie angehalten und sei seine r Genehmigung gewi. Sie schlug ihm sein Begehren rund ab und setzte hinzu, so ger n sie ihn brigens sehn wrde, so habe sie doch als Witwe und als eine Kaufmannsfrau die Nachrede der Nachbarschaft zufrchten. Hierber nun ward er hchlich entrstet, nan nte meinen Namen und mich einen stolzen, hoffrtigen Mann, der doch auch nicht all er Weisheit Herr sei, das knne man an dem Bau sehen; ich werde aber schon meinen Lohn erhalten. Der Kondukteur wolle die andern Gebude um ein Bedeutendes wohlfeil er bauen lassen.
3. Schlu und Entwrfe fr die Fortsetzung der ersten Niederschrift. Goethe. [198] Was Goethe betrifft, so mag ein so dauerhaft vertrautes Freundschaftsband mit diesem auerordentlichen Manne manche Vermutung veranlat haben, insofern Brdersc haften ohne Blutsverwandtschaft wohl beim Trunke entstehn; und so gedenke ich di e Veranlassung dazu hier niederzulegen. Im vorletzten Zehntel des vorigen Jahrhunderts waren einige meiner Liederweisen diesem Freunde zu Ohren gekommen. Da mir die Unzufriedenheit der meisten Dichter mit ihren Komponisten von. alters her nicht unbekannt, und es mir so leicht geworden war, Goethesche Verse zur bun g in Musik zu setzen, so gestehe ich gern den angenehmen Schreck, den ich durch des Dichters Beifall empfand. Was ich von seiner Persnlichkeit aus der Tradition wute, wo nicht selbst die Oppos ition anerkannter Zeitgenossen gegen die Wirkung seiner Schriften, rhrte den tief sten Grund in mir auf. Ich hatte Partei genommen fr ihn, ohne sagen zu knnen, wie und warum, und mein Glaube an jene Opposition, in der ich manchen persnlichen Fre und zhlte, verlor sich endlich ganz. Als nun Schiller seinen ersten Almanach herausgab, erhielt ich den Auftrag, mehr ere Goethesche Gedichte fr [199] diesen Almanach in Noten zu setzen, unter welche n sich Der Gott und die Bajadere und andere ausgezeichnet haben. Dadurch entstand ein, wo nicht lebhafter, doch zusammenhngender Briefwechsel, aus dessen scheinbar leichten Andeutungen ich eifrigst zu erraten suchte, was der D ichter leisten wollen, und was erreicht war. Auerdem wurde auch wohl ber husliche Z ustnde berichtet, von meinem Tun, Treiben und schweren Leiden, woran Goethe den A nteil eines alten Freundes nahm, der mir so wohlttiger werden mute, da ich von mei nen Jugendgefhrten teils durch den Tod, teils durch weite Entfernung getrennt war . Am 12. November 1812 berichtete ich den Tod meines ltesten Sohnes, den Goethe per snlich gekannt, und der sich an dem nmlichen Morgen durch einen Pistolenschu entlei bt hatte. Auf diesem kurzen Briefe folgte eine schnelle Antwort, die mich wie einen Schick salsbruder mit dem vertraulichsten Du anredete. Da ich denken mute, da eine solche Benennung wohl nur momentan aus Menschlichkeit und Anteil eines erschtterten Herzens heraufgesprungen, beantwortete ich diesen B rief zwar mit der Ergieung einer bervollen Brust, doch mit verdoppelter Ehrfurcht gegen einen von mir aufs hchste verehrten Mann. Goethes Briefe aber folgten in dieser Zeit oft genug aufeinander, da ich denken d urfte, an die Stelle eines verlornen Sohnes einen lebendigen Bruder gewonnen zu
haben. Diesem Sohne hatte ich mein Gewerbe bereits abgegeben, welches er recht gut, ja mit Geist zu fhren[200] verstand. Aus den Schulen der wackern Architekten Gilly, Gentz und Weinbrenner war er wohlunterrichtet zurckgekommen, ein fertiger Zeichne r, eben so fertig ein Maurer und nicht ohne Erfindung; in ihm dachte ich zuletzt einen Handwerker darzustellen, der ein tchtiger Knstler heien sollte. Ich selbst beabsichtigte unterdessen eine Reise bis an die sdlichen Grenzen Deuts chlands, welche ich noch nicht kannte. Es wrde vergebens sein, den vernichtenden Schmerz von einer Seite und von der and ern den mchtigen Trostgewinn darzustellen. Aus der tiefsten Trauer, die auch mein em Leben drohete, fand ich mich erhoben, und entschlossen ergriff ich wieder und allein mein gutes Heft und ward gerettet. Wenn ich mich nun der vertrauten Freundschaft dieses ewigen Dichters durch meine Kunst und manches Leiden rhme, so verzeihe ich mir diesen Ruhm gar zu gerne, da man sich doch von redlicher Freundschaft lieber etwas berschtzt als gleichgltig geh alten sieht. Zum guten Beschlusse dieser Errterung meines Knstlerlebens wte ich kaum noch etwas z um Besten zu geben als eine dankbare Anerkennung des vielfltigen Guten, das mir v on Zeitgenossen in bester Flle widerfahren ist. Ich habe gelebt und geliebet! Berlin, den 1. August 1820. Zelter. Johann Samuel Carl Possin. [201] Meinen ltesten Herzensfreund Possin habe ich nicht mehr ans Herz drcken soll en. Erst heut, am 11. Junius 1822, erhalte ich die Nachricht, da derselbe schon i m November vorigen Jahres zu London, wo er sich seit dem Jahre 1792 niedergelass en hatte, gestorben sei. Da finde ich mich denn aufgelegt, nachtrglich noch einma l seiner zu gedenken, insofern wir beide, wiewohl an Gestalt, Charakter und Wese n verschieden, ein Paar ausmachten, ja zusammen wirklich fr etwas galten. Possins Vater war ein vollkommen schner, rein ausgewachsener Mann und sogar dafr b ekannt. Dazu konnte man ihn einen Mann von Geist nennen, denn obgleich er Schuhm acher gewesen war, so hatte er auf Wanderungen die uere Welt so in sich aufgenomme n, da man ihn gern davon reden hrte. Er verstand seinen Vers zu machen und eine We ise dazu; dies trug er singend und sich mit der Violine begleitend so natrlich un d gefllig vor, als wenn er sich mit Flei darauf vorbereitet htte. Eine seiner Wandergeschichten war folgende: Mit noch einem Gesellen war er im Begriff, gegen Abend in Stade einzuwandern und dort Arbeit zu suchen. Die Stadt war jedoch nicht mehr zu erreichen, man mute im nchsten Dorfe bernachten. Doch wovon Zehrung und Schlafgeld bezahlen; denn die Ka sse war rein erschpft. Trotz dieser Verlegenheit zog das lustige Paar in die Dorfschenke. Hier war Verw irrung und Trauer. Der Wirt ging umher, wehklagend und hnderingend, weil [202] se ine Gattin mit dem Tode rang; das ganze Haus war in Bestrzung. Possin suchte den Mann durch Teilnahme zu gewinnen und erfuhr nun, da der Arzt au s der Stadt hiergewesen sei und alle Hoffnung zur Genesung des guten Weibes aufg Das mge mein Ende sein, wie es mein Anfang war.
ekndigt habe. Der Schalk, dem es um eine tchtige Mahlzeit zu tun war, machte ein bedeutendes Ge sicht und lie merken, es mge doch wohl noch ein Mittel geben, die Frau zu retten, wenn man ihm, dem Fremden, vertraue, doch msse er zuvor die Patientin sehen. Puls, Stirn und Brust wurden mit wunderlichen Zeremonien berhrt und versichert, m an habe im Quersack ein geheimes Mittel, und es komme darauf an, ob man's auf Gl auben und umsonst nehmen wolle, denn er drfe es nicht bezahlt nehmen. Nachdem all es zugegeben war, ward der Quersack geffnet, alles mute sich entfernen , das Schurz fell herausgenommen, woran etwas Pech haftete; aus diesem Peche wurden drei Kgelc hen gedreht und der Patientin unter Besprechungen, Kreuzen und Knicksen eingegeb en. Die Wanderer hatten sich's wohl sein lassen und das Beste im Hause erhalten. Pos sin verlangte zu wissen, was man schuldig sei, weil man mit frhestem Morgen aufbr echen msse. Der Wirt beteuerte, da er nichts nehmen werde und ja die Arzenei auch nicht bezahle. So gingen die Wanderer andern Morgens in die Stadt, wo sie soglei ch Arbeit fanden. Den zweiten Sonntag will Possin in die Kirche gehn. Auf der Strae hrt [er] hinter sich her Pst, pst!. Er sieht sich um und erblickt mit Schrecken den Schenkwirt, de r in grter Schnelle auf Possin zueilt, ihm um den [203] Hals fllt und herzt und aus ruft: Herr! Er hat mir mein Weib gerettet! Ihm allein bin ich diese Wohltat schul dig. Meine Frau ist gesund, komm Er zu uns und berzeuge Er sich von meinem Glcke! Dagegen hatte sein Sohn eine vllig ungnstige Vorstellung von seiner eigenen Persnli chkeit, womit eine gewisse Abneigung gegen seine Mutter gerechtfertigt schien. E ine Muhme hatte ihm erffnet, er sei von Geburt das schnste Kind gewesen, seine Mut ter aber habe ihn lange fortgesugt, indem sie ein folgendes Kind unter dem Herzen getragen, was eben deswegen nicht lebendig zur Welt gekommen sei. Dies habe nun auf ihn, den Lebenden, so schdlich gewirkt, da er vor dem zehnten Jahre weder lau fen noch reden noch sehen knnen, und bis zum achtzehnten Jahre mit den ekelhaftes ten Ausschlgen sei geplagt gewesen. Von Geist und innerer Kraft war er dabei der vollkommenste Jngling, und da er sich uerlich fr gering hielt, so gefiel es ihm, sei n ueres zu vernachlssigen. Geriet er nun hierdurch wohl in den Fall, sich zu wehren , so ging er aus solchen Verlegenheiten immer als brav hervor, und ich wte keinen Fall, wo er mit derselben Person zum zweiten Male Hndel gehabt htte. Auerdem war er sittsam, schamhaft, verschlossen, ttig, gerecht, und was er anfing, mute vollendet werden. War er nun nach auen nicht empfohlen, so war in seiner Ges talt nichts Widerwrtiges. Sein Krper war stark, gelenkig, gerade und fest. Er tanz te, ritt und focht mit Genu, wiewohl das Fechten bald unterblieb, um seine Hnde ni cht in Gefahr zu setzen. Auch fehlte eine gute Bekleidung nicht immer, wenn auch , was eben Mode war [204] nicht zu ihm passen wollte, endlich aber Wsche und Bekl eidung selten eher abgelegt wurden, bis der Unschein zu merklich wurde. Hatte er sich aber einmal herausgeputzt, so erschien er fast noch auffallender. Einst waren wir beide zu Gevattern gebeten. Er wollte mich mit einem Wagen abhol en, der eben am Sonntage nicht zu haben war; so erschien er zu Fu in scharlachnem Treffenrocke, in weien seidnen Strmpfen, den Degen an der Seite, bei mir. In solc hem Staate zu Fue ber die Strae zu gehn, war nicht schicklich; noch weniger aber ve rzeihlich, vor dem Gevatterhause anzukommen, ohne aus einem Wagen zu steigen. Do ch die Stunde war da; so gingen wir in unserm Staate, um einen Wagen aufzutreibe n, bis nach dem ziemlich weit entlegenen Fiakerplatze. Hier standen glcklicherwei se noch zwei Kutschen. Eine davon war vllig unscheinbar und vor der andern stande n ein Paar lcherlich schlechte Pferde. Auf Possins Rat wurden beide Kutschen gemietet, und die Kutscher lieen sich gefal len, die bessern Pferde vor den bessern Wagen zu spannen.
Da wir beide auf konomie zu sehn hatten, so ward der Wagen nicht wieder bestellt, indem wir den Rckweg in der Nacht schon allein zu finden hofften. Nun ging gegen die Nacht ein so anhaltender Guregen nieder, da es schier unmglich schien, zu Haus e zu gelangen, ohne unsere Kleidungsstcke, welche neu waren, fr immer zu verderben . Da wir keinen Wagen bestellt hatten, wollte man nicht merken lassen; so gingen wir driest ber die Treppe herab und setzten uns in einen der Wagen, welche da sta nden. Der Kutscher fuhr ab, doch nach einem entgegengesetzten Ende der Stadt, indem wi r ihm zuriefen, da [205] er auf unrechtem Wege sei. Hier merkte der Kutscher Unra t und verlangte, da wir aussteigen sollten, sonst wrde er uns nach dem Gevatterhau se zurckfahren, welches uns sehr unangenehm gewesen wre. Possin kam auf den Einfall, seinen Tressenrock, der ein weiseidnes Futter hatte, umgekehrt anzuziehn; der Tressenhut ward untergesteckt und im bloen Kopfe gegange n. In diesem Aufzuge begegneten uns die ablsenden Soldaten, und wir muten mit in d ie Wache ziehn, wo man sich nicht wenig ber uns lustig machte, als der Offizier u ns sogleich erkannte und auf unsere Bitte erlaubte, den Regen in seiner Wachtstu be abzuwarten. Der grte Spa aber stand uns noch bevor, denn es regnete bis am helle n Morgen, wo wir denn in seidnen Strmpfen zum Spektakel der Begegnenden in lauter Sprngen ber angeschwollnen Gossen und Wasserlchern, ich [im] Chapeau bas und der a ndere im Treffenhute, unsere Wohnungen wieder erreichten. So wenig nun Possin auf ueres zu halten schien, so versumte er nicht leicht die Gel egenheit, mit dem Degen an der Seite zu erscheinen, wie es damals unter Knstlern wohl noch Sitte war; doch fehlte ihm eine Taschenuhr. Ich hatte deren zwei, von denen ich ihm eine ablie, wofr er mir einen ziemlichen Sto Noten abzuschreiben hatt e, womit er dann in kurzer Zeit fertig war. Er glaubte, bei diesem Handel doppel t gewonnen zu haben und sagte: Alle Uhrmacher zusammen wissen vielleicht nicht so viel Musik, als ich beim Abschreiben der schnen Stcke gelernt habe. Nun ging die franzsische Oper ein, und Schulz, der bisherige Musikdirektor daran, ging als Kapellmeister in den Dienst des Prinzen Heinrich nach Rheinsberg. [206] Seine Lektionen in den besten Husern berlie er an Possin, mit dem man noch zu friedener war wegen der Sicherheit und Ordnung, womit er die beste Methode verba nd. Schulz, der sich nun in Rheinsberg an den Gluckschen und Grtryschen Opern auferba ut, lud uns nun einmal ber das andere ein, nach Rheinsberg zu kommen und seine Be wundrung zu teilen. Das war jedoch fr uns kein Kleines. Possins Vater, der Lederh andel trieb, hatte falliert, und dem Sohne war nun die Sorge fr Vater, Bruder und Schwester berlassen. Ich mute unser Geschft auf mehrere Tage verlassen, um zwlf Mei len von Berlin eine Oper zu hren, wiewohl ich auerdem noch begierig war, den Jugen daufenthalt des groen Friedrich zu sehn. Die Sache ward jedoch ins Werk gerichtet; wir waren beide gut zu Fue und lngst gew ohnt, an Sonn- und Festtagen kleine Fureisen zu machen. An einem Sonnabend gingen wir von Berlin ab, und am folgenden Tage waren wir bei guter Zeit in Rheinsberg, um die Iphignie en Aulide von Gluck zu hren. Wir hatten gerechnet, am folgenden Tage zurckzugehn. Der Prinz aber hatte erfahre n, da wir seiner Oper wegen auf Schusters Rappen nach Rheinsberg gekommen waren, lie uns zu einer andern Oper auf den dritten Tag einladen, was gar nicht abzulehn en war, und so verging ber unsere Kunstreise eine ganze Woche. Die gangbaren Gluckschen Opern kannten wir aus der Partitur, doch die Wirkung de rselben auf einem ordentlichen Theater bertraf alle Erwartung, und die Reise nach
Rheinsberg ward von Jahre zu Jahre noch zweimal [207] wiederholt. mischen Abenteuers wegen sei der letzten Reise hier noch gedacht.
Eines tragiko
Wir kamen von Berlin her gegen Abend in dem Dorf Grieben, drei Meilen vor Rheins berg, an, um hier zu bernachten. Als wir in die Dorfschenke traten, begrte uns ein kleiner Bauersmann von etwa vier zig Jahren aufs freundlichste. Er sa hinter einem Tische und hatte einen Krug Bie r vor sich. Wir nahmen Platz am andern Tische und forderten zu essen. Als wir fa st abgespeist hatten, trat der kleine Mann an unsern Tisch und redete Possin an: Kennen Sie mich denn nicht mehr? Possin versetzte, er knne ihn wohl schon gesehn h aben, doch wisse er nicht wo. Mein Gott! sagte der Mann, Sie haben mir ja das Leben gerettet; wissen Sie denn das nicht mehr? Es sind ja kaum zwei Jahre. Meine Frau aber ist tot. Gott gebe ihr die ewige Ruhe, denn mit ihr habe ich keinen guten Tag gehabt, und nun habe ich schon wieder eine andere. So ging das Rtselreden fort, bis sich die Sache folgends erklrte. Als wir das erstemal nach Rheinsberg gingen und diese Gegend betraten, wir waren aufs frhlichste gestimmt, sieht Possin kaum fnfzig Schritte von der Landstrae ab i n den Wald hinein einen Menschen in einem Kittel stehen, der beschftigt ist, eine n Strick oben am Baume zu befestigen. Sieh, sagt Possin, was der Mensch da macht! I ch glaube, der will sich aufhngen. Ich bleibe stehn und sage: Er wird doch nicht to ll sein! Possin geht rechts ab mit groen Schritten auf den Menschen zu und spricht : Was macht Er da? Was soll das werden?! Ach, lassen Sie mich, ich bin ein geschlag ner Mann.[208] Dummer Peter! ruft Possin, reit ihm den Strick aus der Hand und schlgt ihn sanft damit um den Kopf: Wenn Er sich hngen will, ist doch der Wald tief genu g! Schmt Er sich nicht vor Menschen? Der Mann war ohne alle Fassung: Schlagen Sie mich nur nicht, ich will ja gern mit gehn! Wir nahmen ihn zwischen uns und gaben ihn in der Nhe in einem Tagelhnerhause ab, w o wir erzhlten, wie wir ihn gefunden htten. Er war Kuhhirt eines naheliegenden Vor werks und schon eine Weile tiefsinnig gewesen, indem seine Frau, viel lter als er und dem Trunke ergeben, ihn durch harte Begegnung zur Verzweiflung gebracht hat te. Nun folgte hier eine Erkennungsszene, man weinte vor Luft, wie er auf possie rliche Art bekannte, sein Unrecht sogleich erkannt zu haben, wie heilsam ihm die leisen Schlge gewesen, und [wie er] hinzusetzte: Wer wei, wo ich jetzt wre, wenn Si e nicht mein Engel gewesen wren? Aber wie wuten Sie denn, da ich Peter heie? Sie nannten mich ja bei meinem Namen, un d ich hatte Sie noch nicht mit Augen gesehn! Nun wollte er auch seine neue Frau holen, was jedoch abgelehnt wurde, denn unser e Glieder sehnten sich nach Ruhe. Doch fanden wir ihn am andern Morgen um vier Uhr, da wir aufbrachen, uns erwarte nd, um noch einmal zu danken. Die Frau hatte fnf frische Eier, welche uns die arm en Leute mit auf den Weg geben wollten, wovon jeder eins verschlang, von den brig en aber auf einer Fureise keinen Gebrauch zu machen wute[n]. Im Jahre 1787 war Schulz als Kapellmeister nach Kopenhagen gegangen, und Possin erhielt die Kapellmeisterstelle [209] in Rheinsberg. Wenn dieser sich durch solc he Erhebung konomisch zurckgesetzt finden mute, so durfte ihm auch an einem Namen i n der Kunstwelt gelegen sein. In der Direktion einer Musik war er zwar nicht ung ebt, doch war es immer bedenklich, die Stelle eines so angesehnen Vorgngers auszufl len.
Prinz Heinrich sah am liebsten schne Leute um sich; da er jedoch auf dem Theater nur das Franzsische litt, so mute der Kapellmeister vollkommen franzsisch sprechen, und daher ward Possin als gut genug erfunden; es zeigte sich aber bald, da er no ch besser war. Die Rheinsberger Oper kostete dem Prinzen viel Geld, und es waren von Sngern, Akt eurs und Musikern die geschicktesten Leute dabei ttig. Der Prinz selber beschftigt e sich fast ausschlielich mit dem Detail, die angesehensten Hofleute wirkten dazu , aber ein Teil des Orchesters sowohl als der ganze Chor war von diensttuenden H ofleuten besetzt, die dabei noch andere Funktionen hatten und den Theaterdienst als Nebenher versahen. Schulz hatte das Wesen jahrelang mit Verdru hingehn lassen. Der Prinz verlangte d as Vollkommne von seinen Leuten, die sich auf alle Art zu entschuldigen wuten, we nn sie in den Proben fehlten oder ihre Rollen nicht wuten, unterdessen sich alles nach dem Theater drngte, weil sie dadurch besser besoldet wurden. Nachdem sich Possin einige Monate lang mit der Kenntnis der Mittel erkundigt hat te, berichtete er dem Prinzen, wie sich mit diesen Mitteln das Beste erreichen l assen wrde, wenn es Seiner Kniglichen Hoheit gefallen mchte, eine feste Ordnung anz ubefehlen. Ein solcher Befehl stie anfnglich hier und dort an, man wollte sich nicht fgen, bis der Prinz selber bewogen [210] ward, von Zeit zu Zeit dem Anfange der Proben be izusitzen, und nach sechs Monaten war die Oper so in Ordnung, da der Prinz bei ei ner Gelegenheit, wo er vornehme Gstebewirtete, konnte kurz nacheinander fnfzehn ve rschiedene Opern ohne Hindernis und Ansto auffhren lassen. War nun seine Zufriedenheit mit seinem Kapellmeister vollkommen, so entstand and ererseits Eifersucht der Kmmerlinge und sonst Begnstigten, weil sich der Kapellmei ster in allen Dienstangelegenheiten gerade an seinen Dienstherrn wandte und kein er andern Befehle gewrtig sein wollte. Eine Gelegenheit zum Ausbruche dieser Eifersucht zeigte sich nach zweieinhalb Ja hren. Im gewhnlichen Sonntagskonzerte verlangte der Kammerherr (Graf Nugent), da der Kap ellmeister eine Musik herbeischaffen solle, woraus man etwas vortragen wolle. D ie Stcke waren nicht bei der Hand, und Possin sollte sie herbeischaffen. Dieser entschuldigte sich, der Prinz sei gegenwrtig, und Possins Entfernung drfte dem Prinzen auffallen, da er es nicht selber befohlen. Darob ergrimmte der Graf, nannte zuerst den Kapellmeister einen Grossier, den er sogleich zurckerhielt, einen gueux, der ihm auch zurckgegeben ward, und zuletzt s tie er mit dem Fue nach ihm. Possin gab auch diesen Sto, und zwar so zurck, da der Graf rcklings berfiel. Alles dies geschah in der Gegenwart des Prinzen, der jedoch das gewohnte tenuto zu beobachten wute. Nach dem Konzerte forderte Possin sogleich seinen Abschied, den er auch erhielt; der Graf mute sich jedoch [211] noch am nmlichen Abend von Rheinsberg entfernen. Diese Geschichte schrieb mir Possin sogleich nach Berlin; da seit der Zeit seines Abschiedes kein Holztrger mehr den Hut vor ihm ziehe, und da er an einem bestimmt en Tage bei mir einzutreffen gedenke. So ging ich ihm zu Fue entgegen, seiner gewohnten Pnktlichkeit vertrauend, in der
Hoffnung, ihn etwa im nchsten Dorfe ankommen zu sehn. Mit dieser berzeugung ging ich fort in groer Sommerhitze, bis ich ihn hinter Orani enburg, acht Stunden von Berlin, glcklich in Empfang nahm und ihm das erste freun dschaftliche Gesicht entgegentrug. Unsere beiderseitige Freude war unendlich, ich aber von einem Durste geplagt, de n ich in seiner mitgebrachten Weinflasche ertrnkte Johann August Patzig. Ein lterer Freund, der Musikus Patzig, der den Ruf eines grndlichen Klavierlehrers durch gute Schler erwarb, unterhielt ein monatliches Konzert zur bung seiner Schle r, das von uns treulich untersttzt wurde, da es denn kein zu groes Vergngen war, fnf Stunden nacheinander lauter Schler zu hren. Patzig aber, der das Konzert mit der Violine anfhrte, war ein fleiiger Musikus und ein tchtiger Ripienist und hatte unter Hasse und Pisendel im Dresdner Orchester gedient, da wir uns denn im stillen seine Erfahrung zu Nutzen machten. Unter and ern hatte er sich die smtlichen Oratorien und geistlichen Musiken des groen Hasse, die bei uns noch neu und sehr rar waren, [212] in eigenhndigen guten Abschriften zu verschaffen gewut. Da das Verhltnis von Sachsen gegen Preuen durch den Siebenjhrigen Krieg auch im Fri eden ein gespanntes blieb, so traute man sich von beiden Seiten nicht zu sehr; u nd was von Artisten nach dem Kriege zu uns bergekommen war, durfte sich in Absich t auf Kunst wohl etwas ber uns herausnehmen, da ohnehin unsere bedeutendsten Musi ker wo nicht Sachsen, doch Auslnder waren. In Patzigs Konzerte wurden wir bald unentbehrliche Leute, denn da ein Konzert do ch nicht aus lauter Anfngern bestehn kann, und andere Musizi es langweilig fanden , fast nur die leichtesten Sachen von Schlern vortragen zu hren, so waren Possin u nd ich die bestndigsten, und mit uns beiden allein, da wir auf mehrern Instrument en gebt waren, konnte er seine Unternehmung viele Jahre nacheinander in Ordnung u nd Ansehn und daher eintrglich erhalten. Die Musik fing nachmittags um drei Uhr mit einer Sinfonie an, dann folgeten Konz erte und Arien und Sonaten von Eleven gespielt bis acht Uhr, die sich dann nache inander entfernten. Nach acht Uhr wurden nun Konzerte von uns selber bis neun Uh r zu eigener Ergtzlichkeit gespielt, und von hier an erschien eine ganz neue Gese llschaft von Frauen, Schwestern und anmutigen Tchtern der Musiker und Hausfreunde . Nach neun Uhr geno man in so heiterer Umgebung ein frugales Abendessen, dem Wei n und Munterkeit nicht fehlten. Den Beschlu aber machte der geistreichste Aufstan d, indem alles Hand anlegte, Tische und Kommoden auf den Flur zu schaffen, um de n Tanzplatz einzurichten, welchen oft genug die aufgehende [213] Sonne noch bele bt fand. Auch den Tanz hatte man sich knstlerisch zugestutzt, denn indem wir uns selber zum Tanze aufspielten, so komponierten wir uns zugleich neue Tnze, und die Tanzgebten neue Touren. Selbst Hrner und andere Blasinstrumente fehlten nicht, un d waren die Spieler nicht bei der Hand, so wurden sie vom ganzen Chor dazu gesun gen. Die obengenannten Hassischen Partituren, in Patzigs Sammlung aufgestellt, waren von uns lngst lstern betrachtet und durchstbert worden, indem wir kaum dachten, sol che Raritten jemals eigens[d]s zu besitzen. Einst sagte Patzig zum Possin: Nehmen Sie sich doch eine Partitur mit; zu Hause mg en Sie mit Ruhe davon genieen. Possin lie sich dies nicht zwei mal sagen. Abends na ch zehn Uhr kommt er auf meine Stube, Noten und Notenpapier unterm Arme. Frisch a uf! ruft er, nimm eine Feder; hier ist Papier, und hier ist, Die Bekehrung des hei ligen Augustinus' von Hasse. Das alles mu morgen abend fertig sein.
Wir setzten uns an die Arbeit, schrieben eilig die Partitur ab, die Nacht hindur ch, und am dritten Tage ging Possin und brachte die Partitur ihrem Eigentmer zurck , um sich eine andere zu erbitten, die er auch erhielt. So ging die Arbeit vonstatten, bis wir uns das letzte Stck erbeten, was Patzig be sa. Sie sind sehr ordentlich im Wiedergeben, sagte Patzig, und ich gestehe, dergleichen kaum noch angetroffen zu haben, weshalb ich denn auch nicht gern Musikalien ver leihe. Aber Sie brauchen sich nicht zu sehr damit zu eilen. Die Stcke sind mein, und was ich besitze, steht Ihnen so lange als Sie es brauchen, selbst zum Abschr eiben zu Dienste. [214] Nun gestanden wir, da wir smtliche Oratorien von Hasse uns ohne sein Wissen bereits abgeschrieben htten, weil wir nicht gehofft, solche von ihm zu diesem Zwe ck zu erhalten. So entstand zwischen uns und diesem sanften, ruhigen Manne ein freundschaftliche s Kunstverhltnis, das besonders zwischen mir und Patzig zu einer zwanzigfachen Ge vatterschaft anwuchs, indem wir beide, nach und nach Vter zahlreicher Kinder, sol che gegenseitig in der Musik unterrichteten. Patzig hat dies Konzert ber vierzig Jahre nacheinander durchgehalten, und wiewohl Possin nach Rheinsberg ging und ich die letzten Jahre anderer Verhltnisse wegen davon blieb, so hat es der tchtige Mann bis in sein achtzigstes Jahr, das heit: bi s an seinen Tod, aus bloer Liebe fr seine Kunst sich zu erhalten gewut.
4. Zweite Niederschrift der Selbstbiographie. [215] Eine geistreiche, huldreiche Frstin, die Herzogin Amalie von Sachsen-Weimar , der ich im Jahre 1802 die Ehre hatte, auf Befragen manches aus meinem Geburtso rte mit meinen frheren Jahren Zusammenhngende[s] zu beantworten, uerte bei dieser Ge legenheit, jeder fhige Mensch sei schon allein fr den Genu des Lebens selber verbun den, ein schriftliches Zeichen zu hinterlassen, wre es auch nur als Bekenntnisse an sich selber. Ein besserer Lohn fr die Erfindung der Schreibkunst lasse sich ka um angeben. So ward mir zum Andenken dieser edelsten Frstin ein Stein auf das Gewissen gelegt , den abzuheben ich durch sehr trbe Stunden angehalten worden. Es waren die eiser nen Winternchte von 1806 und 1807, die pltzlich, eine undurchdringliche Scheidewan d zwischen Sonst und Heut, wie vom Abgrund zum Himmel aufwachsend sich vor mich hinstellten. Das schwerste Doppelleid fr den einzelnen, der Fall des geliebten Va terlandes und der Tod der edelsten Lebensgefhrtin und Mutter meiner elf Kinder fu hr wie Blitze fast kurz nacheinander auf mich her, und zu meiner Aufrichtung unt ernahm ich, die frhern Tage meines Lebens aufzuzeichnen. Da nun Trauer und Elend in Worte zu bringen mir nicht gegeben ist, und andre Fed ern solches hinlnglich bemerkt haben, so fand sich die Gelegenheit, indem ich als Mitglied des Knstlervereins aufgefordert war, den Lauf meiner Knstlerbahn zu den Akten der Anstalt einzureichen; und so sind, nachdem sich die Aussicht in eine [ 216] hoffnungsvollere Zukunft aufgetan hatte, die folgenden Bltter entstanden. Die Schwierigkeit, ein zerstreutes Jugendleben mit seiner Folgezeit darzustellen , mge entschuldigen, was durch literarisches Ungeschick versehen worden. Ein anhaltend heftiges Schreien am 11. Dezember des Jahres 1758, das kein Ende n ehmen wollte, war das Zeichen meiner Geburt und groer Gefahr. Welch ein Gestirn o
der Unstern sich meiner Ankunft in dieser Welt widersetzt hatte, wte ich nicht zu sagen. Meine Mutter lag fr tot, und ich schrie fort. Frau Schley, eine hilfreiche Gevatterin in solcher Not, ward gerufen. Das Knblein, sagte sie, wird von der schwe ren Arbeit ausgehungert sein. Sie bereitete einen Brei und Getrnk, gab mir davon, und nun lchelte ich die Umgebenden an. Meine Mutter erholte sich, und mein Vater freute sich seines Sohnes. Hatte ich auch allen Umstnden meiner Geburt in Person beigewohnt, so wrde ich darber in vollkommner Unwissenheit sein, wenn sie mir nich t oft genug wiedererzhlt, ja vorgeworfen worden wren, um sie nicht zu vergessen. H atte ich's doch nicht besser zu machen gewut, um auf die Welt zu kommen. Von Schl angenwrgen und dergleichen fiel nichts vor, doch mag ich eines Hundes gern gedenk en, der Nante hie und meine Kindheit bis in das sechste Jahr treu bewachte, beson ders gegen andre Hunde, die ich wohl zu necken pflegte. Einige Hauslehrer, welche nach und nach starben, um meinen Dank fr ihre Erziehung skunst nicht abzuwarten, brachten mich so weit, da ich in das Gymnasium geschickt wurde, wo ich die unterste Klasse zierte. [217] Der letzte dieser Hauslehrer war ein junger krnklicher Theologe und schien mir anfnglich gewogen, wenn nicht meines Fleies, doch (wie er es nannte) meines gu ten Charakters wegen. Die Ursach' erfuhr ich zufllig, denn ich selbst empfand wen ig von seiner Zufriedenheit; er a fast leidenschaftlich gern Mispeln, die er sich um die Jahreszeit tglich einkaufen lie und sie jedesmal sorgfltig zhlte; auch verga er nicht, mir davon mitzuteilen. Da ich aber dieser Frucht keinen Geschmack abge winnen konnte, so legte ich mein Teil still beiseite, um den Mann nicht durch We igerung empfindlich zu machen, was gar leicht mglich war. Einst gab er mir Geld, um Mispeln zu kaufen, und indem ich die fr mich zurckbehaltenen wieder dazulegte, welche durch die Zeit nicht schlechter geworden waren, so wurde bemerkt, da ich e ntweder besser einzukaufen verstand oder meine Vorgnger genascht htten. Zu solchem Einkaufe ward ich denn fter berufen, den ich fr ein zufriednes Gesicht gern bernah m. Eines Abends hatte er meiner Mutter vorgelesen, und ich war darber eingeschlafen. Halb erwacht hrte ich zuletzt von mir reden, wie ich nmlich als ein redlicher Kna be von ihm gepriesen wurde, in welchem wahrscheinlich ein tchtiger Kaufmann steck e, der einen Einkauf zu machen Talent habe; als Beleg ward diese Mispelgeschicht e erzhlt. Dies Geheimnis hatte ich nun meiner Mutter schon erffnet, die ihn lchelnd bedeutete, da ihr Sohn keine Mispeln esse und leicht den schlechtesten Kaufmann von der Welt abgeben drfte. Darber war nun der junge Mann sehr rgerlich, da er mich einen falschen Hund schalt und eine frhere Geschichte wiedererweckte, die nicht weniger kindisch herauskam. [218] Meine Mutter hatte ihre jngste, noch unverheiratete Schwester bei sich, ein gesundes, starkes, mnnliches Wesen. Sie schien nach ihrem Eigenen zu trachten un d sich gedrckt zu fhlen, indem sie uns oft vorrechnete, was sie fr unser Haus wirke . Der Hauslehrer, der eine Pfarre erwartete, mochte von hnlicher Gesinnung sein, und man frchtete, in den gleichgestimmten Seelen mit der Zeit ein Paar zu finden. Nun hatte er der Muhme zur vorigen Weihnachten kleine Geschenke gebracht, worun ter auch eine Maus von Wachs war, die, auf ihrer Kommode stehend, von mir immer lstern betrachtet wurde. Einst war die Muhme in der Kche mit Seifekochen beschftigt . Ich komme in ihre Stube und gewahre unter dem Fenster ein Mauseloch im Fuboden. So gehe ich an die Kommode, nehme das wchserne Tierchen und setze es vor das Mau seloch. Dann schleiche ich in die Kche und flstere: Muhme, eine Maus! eine Maus! Die Muhme kommt: Wo, wo?, mit der Seifkelle in der Hand, und indem sie die Maus sieht , schlgt sie sie in hundert Stcke. Ich machte mich von dannen, sie mit der Seifkel le hinter mir her, und rettete mich zur Gromutter, die mich in Schutz nahm und si e mit einem Verweise abziehn lie. Nun verklagte sie mich bei meinem Vater, der aue r sich geriet vor Lachen, und als er mich weinen sah, mir eine derbe Maulschelle mit den Worten gab: Was weinst du, Schlingel? Der Spa hatte meinen Vater, der von dem Verhltnis eines so ungleichen Paares nichts wissen wollte, in so heiteren Hum or gesetzt, da er die Muhme mit Anwendungen plagte, die denn ich und meine Schwes
ter bei ihr ausbaden muten. Nun fand sich ein tchtiger Zimmermeister, an den sie g lcklich verheiratet wurde. Der Hauslehrer aber ging [219] auch von uns ab und sta rb bald darauf an der Auszehrung. Im Gymnasio lernte ich so viel Latein und Griechisch, um in einige hhere Klassen zu gelangen, in denen ich das unten Erlernte wieder verga und dafr allerlei Bursch enstreiche eintauschte, bis eine Schlgerei, wobei ich mich zu ttig erwies, mir die Relegation zuwege brachte. Um diese Zeit, gegen mein sechzehntes Jahr, hatte ic h, so wie schon vorher meine beiden ltern Schwestern, angefangen, den Flgel zu spi elen. Mein Klaviermeister war ein Organist, und in Jahr und Tag war ich wohl so weit, beim Gottesdienste unter Aufsicht des Meisters den Choral mit der Orgel zu begleiten. Auch so weit wre ich vielleicht nicht gekommen, wenn nicht meine ltest e Schwester Luise, die sich unter allen Um stnden meiner anzunehmen wute, mich ver mocht htte, fleiiger im Spielen zu sein, als meine zu groe Beweglichkeit zulie, inde m sie hoffte, dem Vater, der so gern zu ihrem Spiele sang, nach ihrer bevorstehe nden Verheiratung diese Freude in ihrem Bruder zu hinterlassen. Auf der Hochzeit dieser Schwester sah ich zum ersten Male meinen Grooheim, den Ho fkupferstecher Georg Friedrich Schmidt, der gut musikalisch war. Ich mute ihm vor spielen, und er sagte, das wre schlecht genug; ich sollte nur meine anderen Sache n desto besser lernen. Diese Rede verstand ich nicht recht, weil ich mein Griech isch vergessen hatte. Doch kam mir vor, als ob er mein Spielen nicht gelobt htte. Mein Vater lie mich zur Maurerprofession einschreiben (am 14. Februar 1774 im Hau se des damaligen Altmeisters Herrn Weidner in der Zimmerstrae), welche er selber mit gutem Erfolge trieb. Der Frhling nahete, [220] und eben als ich anfangen soll te zu mauern, befielen mich die Blattern so nachdrcklich, da der ganze Sommer darbe r hinging. Mit meiner langsamen Genesung erwachte ein neuer Trieb in mir zur Mus ik, der mich zum ersten Male in anhaltende Ttigkeit setzte. Ganz fr mich allein fi ng ich an, die Violine zu spielen, um mit dem Flgel abzuwechseln, so da nichts als Musik getrieben wurde. Und wren solcher Neigung von hier an Umstnde gnstig gewesen , so wre man wohl vorwrtsgekommen. Aber aus der Kunst ein Gewerbe zu machen, lag d amals ganz auer der Ansicht eines Professionisten. Man begriff nicht, zu was das Musizieren dienen sollte. Den nchsten Sommer mute endlich gemauert werden. Htte es in meiner Wahl gestanden, so htte ich statt dessen gern noch einmal die Blattern ausgehalten, denn meine Hnd e gerieten durch tzenden Kalk und durch Angreifen des Gesteins so in Unordnung, d a ich des Nachts Handschuhe anlegte, welches bei der Arbeit gern bespttelt wurde. Ein frheres Leiden lag mir auch noch auf dem Herzen. Es war die erste Verheiratun g meiner ltesten Schwester Luise, die ich aufs zrtlichste liebte, da sie mir niema ls widersprach und alles auszugleichen wute. Vielleicht habe ich diese Schwester nie um etwas gebeten oder von ihr gefordert. Was ich wnschte, war immer vorhanden und kam immer von ihr, da ich ihr denn aufs Blut ergeben und immer auf dem Spru nge war, wie ihr schnes Auge winkte. Im elterlichen Hause war dies kaum bemerklic h. Den Hochzeitabend, als sie mit ihrem Manne fuhr, war mir's pltzlich wie ein Sc hnitt in das Herz; ich rasete, weinte, schrie; man mute mich halten; ich wollte i hr nach und kam in so wtende Leidenschaft, [221] da man mich bewachte, aus Furcht, ich mchte mir nachts ein Leid antun. Der Ha, den ich auf meinen guten Schwager ge worfen hatte, war durch kein Zureden zu mildern, wie sich auch meine Schwester g lcklich nannte, und dieser Ha hat bis an seinen Tod gewhrt. Mit leidigem Behagen sa h ich seinen Sarg in die Erde senken, denn nun durfte ich mein Geliebtestes auf Erden wieder ganz lieben. Ein Anfang im Zeichnen und in der Geometrie war schon gemacht. Auf der Kniglichen Zeichen-Akademie ward ich, vielleicht meines Grooheims wegen, vom Direktor Le Su eur freundlich angegangen, und ich mag mich wohl nicht ganz ungeschickt gezeigt haben; denn mein Zeichenlehrer, der damalige Professor Krger, schien auf mich zu halten und gab sich die Mhe, mich in Ol, in halber Figur zu malen, wofr ich ihn he
rnach mit einem schnen Edelinckschen Abdrucke beschenkte. Auch der damalige Direk tor der Akademie, Frisch, erwies mir die Ehre, mich in schwarzer Kreide zu zeich nen. Auf der Akademie machte ich die Bekanntschaft mit dem jngsten Hackert, welch er Georg hie. Mit diesem ging ich in seine Wohnung zu seiner Mutter, wo wir zusam men nach Gips zeichneten, was uns auf der Akademie noch nicht verstattet wurde, und ich ihn dafr im Violinspielen zurechtwies. Um mich gegen Nachrede zu verwahren, welcher ein Meistersohn von Zunftgenossen w ohl ausgesetzt ist, hatte mich mein Vater fr mein drittes Lehrjahr einem andern M eister bergeben, den er selber fr den besten Praktikus hielt; und das war Lehmer i n der Tat. Einen bedeutenden Bau vom ersten bis zum letzten Steine anzuordnen un d durchzufhren, ohne da es schien, als wenn er dabei vorwaltete, war ihm gegeben. Gemauert hatte ich nun [222] den ganzen vorigen Sommer. In diesem Jahre ward das Kadettenhaus in Berlin angefangen und ich dabei in Reih und Glied gestellt. Die Pfeilerwand hob sich wie ein Gewchs aus dunkler Erde ans Licht. Fehler wurden an gemerkt, ehe sie begangen wurden, Nachlssigkeiten durch ehrbare Abgaben gebt; eine rohe Mauer nahm sich heiter, ja appetitlich aus. Was eine gelassene, krftige Anwe isung heit, war nicht zu verkennen. Ich kam in Zug mit andern, durfte mich vergle ichen mit andern und hoffen, ihnen gleich zu werden, wo nicht sie zu bertreffen. Kurz, ich begriff, da jeder von uns an seiner Stelle etwas sei, wenn einer ein Me ister ist. Auch andre Betrachtungen fanden sich ein; man schmte sich nicht, ein M aurer zu heien und den alten Vorwurf zu leiden, da Maurerschwei mit Golde bezahlt w erde. Man hrt solchen Vorwurf oft genug von Unbeschftigten und bedenkt kaum, da nic hts leichter von sich geht als bauen, wenn es dabei nicht an der Zutat fehlt. De r Maurer scheint stillzustehen, und seine Arbeit wchst kaum sichtbar. Dabei leide t er von jeder Jahreszeit; Wind und Regen, Klte und Hitze, alles will ihn vertrei ben; wenn der Schatten fertig, das Dach gedeckt, der Keller gewlbt ist, berlt er and eren den Vorteil, und der Winter legt ihm das Handwerk ganz. Eine Unvorsichtigke it, ja fremde Schuld setzt oft genug seine Familie in den Waisenstand. Solche Be trachtungen hatte ich freilich schon frher angestellt und gefunden, da ich mich zu m Handwerke nicht schickte, da ich jetzt aus Achtung gegen meinen Meister mich a uch den schweren Arbeiten als Brechen, Graben, Rsten im Wassermauern nicht entzog , was ich allenfalls gedurft htte. Auch war mir ein Sinn der Handwerks-Ehrbarkeit angeboren, demzufolge ein Maurer seine Prosession [223] zu den unvergnglich edle n rechnet. Sittenlosigkeit und Unzucht wurden von der Gesellschaft selber oft sc hwer geahndet, selbst kleinere Vergehen; Befleckung eines Mauerwerks, lose, frec he Reden bei der Arbeit blieben nicht unbestraft; auch ein leidenschaftliches Ve rhltnis in den Lehrjahren mute beim Lossprechen abgebt werden. Hierin nahm sich unse r Meister geschickt und meines Wissens niemals scheltend. Wenn sein Falkenauge e inzelne Fehler gewahrte, richtete er seinen Vorwurf gegen die Mitarbeitenden, ob sie es so recht fnden, und ging sogleich von dannen. Der Snder hatte sich nun mit den Seinigen abzufinden, und wenn er sich hier zu hart angezogen hielt, rief er endlich wohl noch den Meister um Beistand an. Schlechtes Werkzeug, zerrissne Kl eider, wunderliches Erscheinen auf der Arbeit galten ihm fr Zeichen eines unbrauc hbaren Menschen. Fr solche, meinte er, wre die Welt gro genug, wenn auch bei ihm ke in Raum. Mit diesen gemeinschaftlichen Eigenschaften unterschied sich Lehmer dad urch von meinem Vater, da jeder Gesell, der Lust hatte zu lernen, zu ihm kam, und wer von ihm gelernt hatte, meines Vaters Arbeit suchte, welcher letztere seine Leute, wenn sie schne Arbeit machten, auszeichnete, beschenkte und sie gern durch winterte, indem er ihnen andere Beschftigung gab. Dies wurde von Lehmern keineswe gs genehmigt, welcher meinte, der Winter sei die Verdauungszeit des Maurers, der den Frhling sehnschtig zu erwarten habe; gute Arbeit aber zu machen sei er schuld ig, denn nur dafr gebhre ihm der Lohn aus der Hand des Meisters, der nicht wie ein Liebhaber ein fertiges Werk bezahle; das Handwerk sei keine Kunst, und ber das H andwerk hinauszutreten sei auch keine Kunst. [224] Lehmer war aber auch ein Musikus und wute sich etwas damit, auf der Violine und dem Violoncelle nach Noten zu spielen. Bauen und Musik waren ihm unzertrenn liche Dinge. So kam denn in Wintertagen ein kleines Konzert bei ihm zusammen, wo bei auch ich ttig war, indem ich bald den Flgel, die Violine, Flte und was eben erf
ordert wurde, und hier gleichsam den Meister des Meisters spielte. Da ich schon komponierte, so wurden meine Versuche hier ans Licht gezogen, und wie sie nun ge gen andre beliebte Stcke ausfielen, belchelt oder belobt. Damit ich mir aber auch hier nicht zuviel zugute tat, so hatte Lehmer meinen Violinmeister Schultz, welc her die Komposition recht gut verstand, mit in sein Haus gezogen, weshalb ich mi ch denn nicht mausig machte, weil Schultz mir die Fehler laut und derb verwies. Zu diesen Winterlustbarkeiten gehrte noch das Montagskonzert im Brunowschen Garte n, wo man Sinfonien, Konzerte und italienische Opernarien (welche letztern auf d er Oboe geblasen wurden) hrte. Ein Jude namens Lewin fhrte dies Konzert nicht unge schickt an, was in einer rauschenden Gesellschaft, im Nebel unzhliger Tabakspfeif en nicht leicht sein mochte. Was hier meine Aufmerksamkeit zuerst auf sich zog, war der Paukenschlger Froloff, der meines Wissens noch lebt. Dieser schlanke, lan ge Mann wute durch eine sinnreiche Fhrung der Schlgel, welche er an beiden Enden ge brauchte, ein interessantes Spiel fr alt und jung zu veranstalten und mir einen g anz unverhofften Respekt gegen ein Paukenpaar abzugewinnen. Ich wte kaum zu sagen, ob seit all der Zeit eine Paukenmusik noch zu hnlichem Anteil bewegt htte. ber ein em ruhigen Wirbel als Grundton flo ein phantastisch melodisches Wesen daher, [225 ] das man zu verstehen glaubte; durch eine Anzahl Kurven, welche sein Schlgel vom Zentro nach der Peripherie und zurck beschrieb, entstanden Tonleitern nach oben und unten, denen er durch Anwachsen und Zunehmen eine modulatorische Haltung zu geben wute. Trnen flossen, wenn sein crescendo sich zu Schlgen erhob, als ob das Fi rmament krachte, ungerechnet eine Menge von Knsteleien, womit er Frauen und Kinde r ergtzte, indem whrend des Spieles die Schlgel, in die Luft geworfen, auf die Pauk e fielen und von da aufgefangen wurden. Dabei war ihm eine seltne Eigenschaft na trlich, indem er, die Umstehenden im Auge, zu schlieen wute, wenn er sein Hchstes er reicht hatte. Dies war endlich nicht sein ganzes Verdienst. Sein Paukenpaar bele bte, ja es dirigierte das Orchester. Eine Sinfonie, von ihm begleitet, durfte je der zu hren wnschen, obgleich es schien, als ob die Schlgel kaum die Felle berhrten. Da ich ihm gnstig war, so war auch er mir gewogen, indem ich ihm oft etwas aufga b, das er auf der Stelle ausfhrte. Sein Paukenpaar hielt er wie Augpfel. Wenn ein Stck aus war, hing er seine Schlgel an den Knopf seines Kleides. Einst wute ich ihm die Schlgel unvermerkt abzunehmen, um seine Pauken damit zu versuchen. Froloff k am wie ein Pfeil geschossen; mit einem Griffe waren die Schlgel in seiner Hand. D ann machte er selber eine Kadenz, die ich unvollendet gelassen, und steckte die Schlgel in den Busen. An diesem Orte machte ich [die] Bekanntschaft des jungen Possin, nachherigen Kap ellmeisters des Prinzen Heinrich. Possin spielte hier Flgelkonzerte, und indem ic h ihn beobachtete, fand ich bald, da er viel weiter war als ich. Alle Stcke ohne U nterschied wurden damals mit [226] dem Flgel begleitet, der den bezifferten Ba mit spielte, wodurch ich denn Luft bekam, das hnliche ffentlich zu versuchen, wenn ich nur herangekonnt htte. Hierzu fand sich endlich die Gelegenheit. Ich stand hinter Possin, und indem die ser von Nasenbluten befallen war, huschte ich auf den Flgelstuhl und vollendete d as Stck, so gut ich vor Eifer dazu kommen konnte. Hier merkte ich zuerst, wie wei t ich in der Begleitungskunst war, und da zum Spielen die Finger allein nicht hin reichen. Nach drei Lehrjahren wurde ich Maurergesell. Da mir das Handwerkswesen von Grund nicht zusagen wollte, so dachte ich es nun baldigst wieder zu verlassen und daz u meine Wanderjahre zu benutzen, ohne welche man nicht Meister werden konnte, wi e ich es doch sollte. Mein Unstern wollte es anders. Denn eben um diese Zeit hob der Knig Friedrich der Groe die Pflicht der Wanderjahre auf, weil mehrere Kantonp flichtige im Auslande geblieben waren, um sich dem Soldatenstande zu entziehen. Unterdessen hatte ich mich an unsern Stadtpfeifer George gemacht, der Gesellen u nd Lehrjungen unterhielt. Mit diesen letzteren, die freilich auch nicht appetitl ich zu schauen waren, ging ich spielen auf Hochzeiten und Gelagen, auf die Stadt trme, um abblasen zu helfen, und schickte mich in iche Sitten.
Wenn dieser George seine Leute hart und rauh anlie, so tat es mir fast wehe, scho nender behandelt zu werden. Da er ein sehr geschickter Mann war, so war sein Sch elten und Schimpfen meinem Ohre so gut Musik wie sein Spielen, und ich wrde meine n Vater, den ich sehr liebte, angebetet haben, wenn er mir verstattet htte, statt des gottlosen Mauerns die Stadtpfeiferei zu erlernen. Daran aber war gar nicht zu denken, wie denn diese Leute [227] damals wenig galten, indem sie bei Aufwart ungen sich eine Behandlung gefallen lieen, die gegen ihren Knstlerstolz abstechend genug war. Durch den hufigen Besuch solcher Konzerte, welche in ffentlichen Grten wchentlich gegeben wurden, hatte ich, wie schon bemerkt, die Bekanntschaft des na chmaligen Kapellmeisters Possin gemacht, der die Musik auch aus Neigung trieb, d enn auch er hatte nach Bestimmung seines Vaters die Handlung erlernen mssen. Dies em Freunde bin ich aufs hchste verpflichtet worden, denn wie sein Eifer zur Musik den meinigen zu berbieten wute, so war er von vornherein grndlicher unterrichtet w orden, und durch ihn konnte ich nachholen, was ich anfangs versumt hatte. Ich war nmlich in der Fingerordnung vernachlssigt und fhlte diesen Mangel am meisten, als ich Konzerte bte, wo denn dieser Freund mich zurechtewies. Zu dem nchsten Konzerte , das ich mit Begleitung spielte, hatte ich mir eine schwere Kadenz ausgearbeite t und hoffte meinen Possin, der zugegen war, damit nicht wenig zu berraschen. Als ich an die Kadenz kam, war mir der Anfang derselben entfallen, und ich sa wie ei n Stock vor dem Flgel, indem das Orchester die Kadenz erwartete. Possin rief mir leise zu: Mache doch den Triller! Ich sa ohne Bewegung. Nachdem er zwei- bis dreima l gerufen hatte, sagte er endlich: Du Rindvieh, mache doch den Schlutriller!, und n un erwachte meine Kadenz, die mir von den Fingern ablief, worauf denn unmiges Gelch ter und Beifall in Menge folgte. Von meinem verdienten Lohne als Lehrbursch hatte ich mir so viel erspart, eine S teinersche Violine zu kaufen, die so gut war, da ich vierundzwanzig Jahre darauf gespielt habe, ohne eine bessere zu wnschen. [228] Mein Grooheim Schmidt war eben am 25. Januar 1775 gestorben; sein fr einen Kn stler bedeutendes Vermgen fiel an seine beiden Schwestern, von denen die eine mei ne Gromutter war. Der Anblick eines ordentlichen Knstlerhauses, das ich hier zum e rsten Male sah, wirkte elektrisch und besttigte meinen Widerwillen gegen das Hand werk. Die Hauptentdeckung aber in Schmidts Hause, welche ich sogleich machte, be stand in einer Garnitur musikalischer Instrumente, um ein vollstndiges Konzert au szustatten. Eine italienische Violine, eine Bratsche und ein gutes Violoncello a us diesem Vorrate wurden mir sogleich zuteile, die ich wie Siegeszeichen auf mei nem Rcken am hellen Tage nach Hause trug. Schmidt war der berhmteste, wo nicht der geistvollste deutsche Kupferstecher sein er Zeit. Er war im Jahre 1712 am 24. Januar mit Friedrich dem Groen in einer Stun de geboren. Die Freude seiner Mutter, als sie die Kanonen um die Geburt des Kron prinzen donnern hrte, berbot die Schwche der Wchnerin, indem sie ausrief: Ich habe ei n groes Glck geboren! Mein Sohn wird die Freude und die Ehre seines Namens sein! Di es Familienzeichen ward in unserm Hause an jedem 24. Januar aufgefrischt, wie al les, was sich nur mit dem groen Friedrich in Beziehung bringen lie. Wenn solche An regungen von einer Seite und auf der andern die Aussicht auf ein nhrendes und edl es Gewerbe, das fast alle schnen Knste umfat, wozu mir aber die Neigung fehlte, mic h hin und her rissen, so war ich auch leichtsinnig genug, in den Tag hinein zu l eben, so da von keiner Seite etwas Ordentliches geschah. Schon beim Stadtpfeifer hatte ich nach Art dieser Leute alle gangbaren Instrumente versucht, ohne auf ei nem etwas Rechtes zu [229] leisten. Auf die nmliche Art wurde komponiert, Sinfoni en, Konzerte und was mir gefiel, zu schreiben, ohne etwas zu vollenden. Dazwisch en wurde gezeichnet, Mechanik und Perspektive, welche auf der Akademie gelehrt w urden, getrieben, Verse gemacht, sogar italienische und lateinische, und was son st so gut war als nichts. Auch hatte man sein Schtzchen, und zrtliche Briefchen wo llten auch geschrieben sein. Ein Freund meines Vaters lie seine Tchter im Tanzen u nterrichten, wozu auch ich gezogen war. Der Mann war ein wohlhabender Butterhndle r und nicht ohne Ansprche auf gesellschaftliche Bildung, denn seinen Hund nannte
er Canis und seine Tchter lie er im Franzsischen, im Singen und Spielen unterrichte n, wie es die Zeit erforderte. Hier lernte ich den sehr geschickten und fleiigen Organisten Ringk kennen, der mich lieb gewann wegen meiner Luft zur Musik, und i ch wte ihm manchen Fingerzeig zu verdanken. Da in diesem Hause fast alles musikali sch war, denn auch der Vater spielte Violine, so fand ich hier Gelegenheit, ein Konzert anzuordnen, das ich beschaffte und dabei so despotisch verfuhr, da, als m an zugleich eine zrtliche Neigung zwischen mir und der sehr artigen jngsten Tochte r bemerkte, man sich meiner auf gute Art zu entledigen wute. Denn als ich eines A bends mein Konzert abgespielt hatte, sagte der Vater, nachdem er mein Spiel bermae n gelobt, ganz lakonisch: Mit heut hren unsre Zusammenknfte vor der Hand auf, weil die Nachbarn darber reden, da in einem Butterkeller Konzerte und noch andre Dinge gehalten wrden. In der Geometrie war ich etwa so weit, um die Prfung als Feldmesser zu bestehen, weil ich nichts anderes dachte, als mich nur erst vom Handwerke zu entfernen. [230] Dazu wollte jedoch mein Vater nicht lauten und bergab mich dem Geheimen Rat Riedel dem ltern zum Unterricht in der brgerlichen Baukunst. In Riedels Hause fan d ich ein Klavier, einen alten Jger, der Orgel spielte und ausgelassen musikalisc h war. Riedel selbst kannte nichts ber Musik. Dieser erfand am Klaviere phantasie rend artige Melodien, die ich zu Papiere brachte und auf gefllige Art variierte. Da ich ein flinker Bursch und nicht ohne allgemeine Fhigkeit war, so wurde ich me inem Riedel bald so wert, da er mich nicht gern vermite und mich auf Baukommission en als Kondukteur mit sich in die Provinzen fhrte, wodurch ich nicht ohne Gewandt heit in Baugeschften blieb. Da ich ihm treu ergeben und unverdrossen war, so durf te er mir manches anvertrauen, daher er denn bis an seinen Tod mich seiner innig en Freundschaft gewrdigt hat. Indem ich mich unter Riedel praktisch mit Mechanik und Statik beschftigte und des halb die Wassermhlen der Stadt besuchte, ward ich mit dem Mhlenmeister Bruwill bek annt, der die Werderschen Mhlen beschaffte. Diesen fleiigen und geschickten Mann a rbeiten zu sehen und ihm dabei helfen zu wollen, war mir ein rechtes Fest, und d a er sich eine kleine Orgel, eine Violine, auch einen Flgel nach guten Mustern ve rfertigt hatte, so besuchte ich ihn oft genug, da man denn zuletzt aus der Mhle h inaufstieg in die Mansarde, wo die einzige Tochter, etwa in meinen Jahren, sich auf dem genannten Flgel nicht un eben hren lie. Ganz natrlich ward hier sogleich geankert, um nach und nach fast tglich um ein schc hternes, sittsam erzogenes weibliches Wesen zu sein, dessen Fhigkeit ich bald bew underte. Ich lehrte sie, so gut ich konnte, einen bezifferten [231] Ba spielen. E s ward gesungen, und sie fand so schnell das Rechte, da mein Wissen bald nicht me hr ausreichte und ich in die Notwendigkeit kam, mich selber vorzuarbeiten. Da ich mich hier wie ein Bruder betrug, so blieb ich ganz wert gehalten. Der Vat er wollte mir wohl, und die strenge Mutter schien mich gern bei ihrer Tochter zu sehen. Ein miges Quartett hatte schon vor mir sich hier zusammengefunden, woran a uch Possin teilnahm, und endlich fanden sich noch zwei Flten dazu. Die beiden Blse r waren Brder und verwandelten dies einsame Mhlenkonzert, welches alle vierzehn Ta ge stattfand, in ein Krnzchen, das nun wchentlich gehalten wurde. Rosine, die Schw ester dieser Brder, ein frisches, entschlossnes Mdchen, die wohl an Werthers Lotte erinnern konnte, war nicht musikalisch, aber ausnehmend liebenswrdig. Sie hatte ihren Brutigam durch den Tod verloren. Der junge Mann war mir wert gewesen. Er fhr te unsre Konzerte an, und ich spielte mit ihm von einem Blatte. So sehr mir das Mdchen gefiel, hatte ich keine Absicht, mich ihr besonders wert zu zeigen. Ich na hm Anteil an ihrem noch frischen Verluste, was jedermann tat, denn jedermann sah sie gern. Ohne Poschen, Culs und falsche Aufstze trug sie sich so nett und eigen , da sie ohne Neid gefiel, wie denn auch ihre kleine Haushaltung ein Muster war v on Sauberkeit und Ordnung. Da ich auer den Konzerten auch hier mit dem Brderpaare abends Trios spielte, ward b
ald genug bemerkt, und als ich eines Nachmittags in die Mhle kam, die Mutter alle in fand, zog diese etwas heftig los auf die jungen Mnner, welche von einer Blume zur andern naschen. Diese Predigt, welche ich geduldig ausgehrt [232] hatte, veru rsachte, da ich seltner und zuletzt nur zu den Konzerten in die Mhle kam. Die hieraus entstandne Lcke in musikalischen bungen fand ich Gelegenheit dadurch z u decken, indem ich in Komdien und Opern die Violine mitspielte, dadurch ein frei es Theater gewann und doppelt entschdigt war. Um diese Zeit war der treffliche Georg Benda von Gotha nach Berlin gekommen, den ich im Orchester des Dbbelinschen Theaters kennenlernte, woselbst er die Proben seiner Opern und Melodramen eigen[d]s anfhrte. Indem ich diesen Proben mitspielen d beiwohnte, mochte der gute Benda meine Teilnahme an seiner Musik und an seiner Direktion wahrgenommen haben, denn wo er mich sah, war ich seines freundlichen Grues gewi. Er lie das Orchester fast allein gehen, als wenn er zu erfahren gedchte, ob und wie es sentierte. Dann pflegte er durch geme Worte aus dem Stcke selbst daz wischenzureden. Dadurch wurde das Orchester zur mithandelnden Person und blieb i m Zusammenhange mit dem Theater. Was auf diese Art gelang, konnte ihn in sichtba res Entzcken setzen, und unser Orchester hatte sich noch niemals so belohnt gefun den. Nun konnte er auch ernsthafte Forderungen machen, die man ihm als einem gef eierten Gaste wohl zugestand. Von italienischen Sngern her war ein Gebrauch auf d ie damals noch jugendliche deutsche Oper bergegangen, demzufolge die Snger in den Proben sich kaum hren, noch weniger verstehen lieen (ein Gebrauch, der lngst wird a bgekommen sein; wir erzhlen alte Geschichten). In einer Probe der Oper Romeo und J ulia zu Anfang des zweiten Akts tritt Laura, Juliens Kammerfrau, heraus mit den W orten: Ach, eben schlo ihr trnenmdes Auge der [233] Schmerzenstiller Schlaf. Diese Wo rte wurden so unvernehmlich gesungen, da Benda die Sngerin anredete: Wer schlft denn Die Sngerin fate sich und sagte: Verzeihen, Herr , die Herrschaft oder das Gesinde? Kapelldirektor, ich dachte, es sei Probe? Die Probe, meine schne Laura, versetzte Be nda, ist eine Auffhrung, und zwar fr uns. Unser Beifall will auch verdient sein; wi r probieren nicht ob wir knnen, sondern vielmehr was wir knnen. Die Szene ward von neuem wiederholt, und die gefllige Sngerin wute den guten Humor wiederherzustellen. Nun aber an der nmlichen Stelle bliesen die Hrner etwas zu scharf. Sachte, sachte, meine Herren! rief Benda, bitte, bitte, nun hren Sie es ja: das liebe Kind ist ebe n eingeschlafen. Da wir sie ja nicht wieder aufblasen! Unter solcher Anfhrung kam d as Orchester mit wenigen Proben so in eins, da die Proben selber zum grten Vergngen der Teilnehmer ausfielen. Einst fate ich den Mut, ihn zu fragen, ob ich ihm wohl ein Violinsolo von seiner Arbeit vorspielen und um seine Zurechtweisung bitten drfte, was er hchst freundlic h erlaubte. Nachdem ich mein Solo abgespielt hatte, sagte er nach einer sehr lan gen Pause in seinem bhmischen Deutsch: Wenn ich mit der Absicht spiele, um mich hre n zu lassen, so stelle ich mir vor, ich spiele aus dem Stegreife, tue auch wohl hinein, was nicht eben dasteht; auerdem halte ich das Abspielen der Konzerte fr ni chts mehr als das Aufsagen eines Pensums, denn wenn es mir kein Vergngen machen s ollte, so wte ich gar nicht, wie ein anderer daran wollte Freude haben. Mit dieser Lektion ging ich, eben nicht geschmeichelt, von dannen und hatte sie nicht einma l verstanden. In der [234] Nacht wachte ich auf. Das Wort des Meisters ging mir wie ein Mhlrad im Kopfe herum; das Solo wurde wieder vorgenommen, und nun merkte ich, da manches unbeholfen herauskam, wie ich es auch bte. Endlich glaubte ich, hi nter das Rtsel gekommen zu sein; ich vernderte die Konzertstimme nach meiner Hand, spielte sie ohne Sorge und zuletzt sogar mit Beifall.
Die Brder waren nun eigentlich meine Leute nicht. Sie trieben Chemie; das Blasen auf der Flte ging ihnen schwer ab und wollte nicht besser werden. Desto lieber wa r mir die Schwester geworden, und um ihretwillen hielt ich aus. Eines Abends wur de vom ltesten Bruder behauptet, die Flte sei ohne Vergleich das schwerste aller I nstrumente, was nicht bestritten wurde, da er kein andres Instrument spielte. Ro sine, welche jede Unterhaltung zu beleben wute, verlangte durchaus meine Meinung, und ich sagte: Man kann, was man will, wenn man die Nase danach hlt! Nun, sagte der
teste, so halten Sie einmal die Nase danach! Wollen Sie einmal, was man kann, und blasen ber vier Wochen ein Fltenkonzert! Wenn ich nun aber nicht wollen will, sagte ich, so brauche ich auch nicht zu knnen! Sie sind es ja, nicht ich, der da will! In dem fiel mir mein guter Kapelldirektor Georg Benda ein. Ich fuhr fort: So etwas t ut man nicht um nichts! Gbe es etwas zu schmausen dabei, so liee es sich Rat leben . Rosine, die gern kochte, war gleich mit einem artigen Souper bei der Hand, inde m sie zugleich die migen Kosten veranschlagte, die der Verlierer bezahlen sollte. Ich vernderte nun ein bekanntes Fltenkonzert so, da die Begleitung die nmliche blieb und ich die Hauptstimme ohne Anstrengung herausbringen konnte. Meine Wette war, [235] nicht ohne alle Widerrede, gewonnen; aber Rosine hielt darauf, da mir kein Unrecht geschehen durfte, und man hatte einen lustigen Abend. Solche Spe zogen mi r auch wohl manchen Beinamen zu, den Rosine erfand, und nun hie ich: Der Konzertme ister. Ein andrer Beiname entstand auf folgende Art: Der Dicke so nannte man den jngsten B ruder hatte sich verheiratet. Die Frau war guter Hoffnung und ihre Entbindung nhe r, als sie selbst glaubte. Eines Nachmittags fand ich die beiden Eheleute ganz a llein und wurde gebeten, dazubleiben, um L'hombre zu spielen. G egen Abend klagt e die Frau ber Wehen, welche so pltzlich zunahmen, da der Mann in grter Eile fortlief , um Hilfe zu holen, die auch nicht lange ausblieb. Unterdessen aber war bereits ein Sohn angekommen, den ich auf meinen Knien zwischen meinen Hnden hielt und de n kleinen Zappler der Geburtshelferin auslieferte, die denn das letzte verrichte te. Ich war einer Ohnmacht nher als die Wchnerin, welche sich ganz munter befand, und als Rosine nach Hause kam und die Geschichte erfuhr, sagte sie: Das ist ja ei n Junge wie ein Hirsch! Und nun hie ich Der Hirschfnger.
Ein edler Mann bewarb sich um die Hand des trefflichen Mdchens, und sie lebte als glckliche Mutter zweier tchtiger Shne. Was mich schon frher, und endlich ganz von d iesem Hause entfernte, will ich nicht verschweigen. Eine von Rosinens Freundinne n fand sich gern des Abends zu uns, eine ausgewachsne ernsthafte Figur mit groen blauen Augen. Einige Gedichte, die mir Rosine in Musik zu setzen gegeben, waren von dieser Freundin, ohne da ich es wute. Als ich sie vorsang, sah man Bella zum e rstenmal auf das huldreichste lcheln. Sie sah ber [236] allen Ausdruck schn [aus], und ich war nicht ungeneigt, solche Wirkung meiner Melodie zuzueignen. Nach und nach fand man sich mehr zusammen. Ich begleitete sie oft nach Hause, und was wir sprachen, gefiel uns. Eines Abends in unsrem Kreise war ich ausgelassen aufgerum t und konnte mich wohl ber Ma verstiegen haben. Bella ward still und entfernte sic h noch vor dem Abendessen. Rosine ging ihr nach und kam verdrielich zurck. Sie wei n icht, was sie will, sagte Rosine; sie will sich nicht halten lassen. Ich will's nu r heraussagen: Bella glaubt, Zelter ist betrunken, wovor sie einen groen Abscheu hat. Glauben Sie das auch? fragte ich hastig. Das ist ja eben, als wenn ich sagte: B ella ist verrckt, wovor ich einen groen Abscheu habe. Der Vorfall wurde durchgespro chen, und kurz, es war ein verdorbner Abend. Das wollen wir bald wieder zurechtse tzen, sagte Rosine. Bella ist nicht gescheit. Sie sieht Sie gern, sehr gern. In Su mma, ihr habt euch alle beide lieber, als ihr es selber wit! Ich ward ungeduldig, glaubte mich beleidigt und sagte: Sie reden wie ein Kind! Dann rede ich auch die Wa hrheit! versetzte sie, was wollen Sie leugnen, was ich besser wei? Was kann ich dafr, agte ich, wenn Sie besser wissen, was ich nicht wissen will! Das ist ein andres, sag te Rosine, die recht geschickt einzulenken wute.
Eine aufrichtige Neigung zu diesem edlen Mdchen konnte ich mir freilich selbst ni cht verbergen, die jedoch mit einer Art von Furcht vor ihrer Gegenwart vermischt war, weshalb ich ihr am liebsten schrieb. Nach etwa acht Tagen begegnete ich Ro sinen auf der Strae. Wo wollen Sie hin? fragte sie. Zu Ihnen! war meine Antwort. - Gu , sagte sie, kommen Sie mit herauf zu Bella, [237] und in einer halben Stunde gehe n wir zusammen. Ich lie es geschehn. Bella fanden wir am Fenster sitzend, und eine Freundin bei ihr. Sie war still und schien mir wundersam anders aussehend. Ich wute allerlei zu erzhlen, was sie nach gewohnter Art ruhig anhrte. Zum Abschiede er innerte ich sie, mir gewisse Verse mitzugeben, wel che in Noten zu setzen sie mi ch schon ersucht hatte.
Auf einmal fielen ihr groe Schweitropfen vom Haupte; sie schumte, sprang umher, sch rie, schlug und stie um sich; kurz, sie ward vor unseren Augen vllig rasend. Meine gute Kraft war nicht hinreichend, sie zu halten, um die erschreckendsten Gebrden zu verhindern. Die beiden Frauenzimmer wurden zurckgestoen. Endlich kam Hilfe, un d wir muten dem geliebten Wesen die schnen Arme binden sehen, indem sie auf herzze rreiende Art ber Gewalt schrie. Der Schreck und die Pein bei dieser Arbeit bedarf keiner weiteren Worte; ich sel ber frchtete unsinnig zu werden und konnte lange keine Ruhe finden. Sie starb wahrscheinlich im Irrenhause. Ich hatte nicht das Herz, danach zu frag en und groe Mhe, mir das edle Bild wieder in seine vorige Anmut zurckzurufen. Nachh er verlautete, ein junger Militr von Familie habe sich um sie beworben; der Vater aber habe das Verhltnis nicht gestatten wollen, weil der junge Mann dem Trunk er geben gewesen. Ihre Schwester war an den Mathematiker Euler verheiratet. Rosinens Verheiratung schien kein Hindernis zu sein, mein Wohlgefallen an ihr zu behalten, indem sie sich als Frau womglich noch besser ausnahm. Eines Abends kam en wir in grerer Gesellschaft von einer Landpartie [238] zurcke; jeder fhrte seinen Part, und da Rosine sich zu mir zu halten pflegte, weil wir beide frisch auf den Beinen waren, so waren wir allein weit voraus an Rosinens Wohnung angekommen. W ir hatten die beiden Treppen erstiegen und standen vor der Tre, als Rosine ausrie f: Nun knnen wir eine Stunde hier warten! Mein Mann hat den Stubenschlssel! Das hat n ichts auf sich, versetzte ich, zog meinen eignen Stubenschlssel hervor und schlo zu meiner eignen Verwundrung die Tr damit auf. Als die anderen nachkamen, fanden si e das Abendessen serviert. Man setzte sich zu Tische. Wie bist Du denn hereingeko mmen? fragte der Mann, ich habe ja den Schlssel bei mir! Rosine erzhlte nun in aller Lust und Unschuld den Vorfall, und es wurden spahafte Glossen gemacht, deren Wirk ung mich hinlnglich belehrte, wie weit man in solchen Dingen gegen respektable Pe rsonen zu gehen habe. Possin, der nach dem Willen seines Vaters die Handlung hatte lernen mssen, besa ei n glckliches Naturell, Widerwrtiges gefat zu ertragen, ja sich solches zunutze zu m achen. Sein Lehrherr stand in Verbindung mit franzsischen Handlungshusern. Durch d iese Gelegenheit ward Possin der franzsischen Sprache und des Buchhaltens so mchti g, da man ihn nach vollbrachten Lehrjahren ungern fahren lie. Unterdessen hatte er sich durch *** beim Lotteriewesen eine Sekretrstelle ausgemittelt, die ihm so vi el Zeit brig lie, in der franzsischen Oper die Bratsche so gut als mglich zu spielen . Hier lernte er den nachmaligen Kapellmeister Schulz kennen, der das Orchester anfhrte. Da Schulz ihm nicht gewogen war, wurde bald bemerkt, und Possin [239] frch tete deswegen, vom Orchester verabschiedet zu werden, woran vielleicht sein ueres mit schuld sein mochte. Auch hier wute er sich jedoch zu helfen; er ging zum Musi kdirektor, der ihn bis jetzt nach auen beurteilt hatte, und bat um seinen Unterri cht in der Komposition. Schulz wies ihn lchelnd an Kirnbergern, dessen Schler er s elber war, mit dem Bemerken, da Kirnberger der bessere sei. Possin sagte, er wnsch e sich nur erst das Gute; das Bessere, hoffe er, werde sich finden; darum sei er hieher gekommen und bte Herrn Schulz, sich seiner anzunehmen. Schulz, liebenswrdi g und verstndig, mochte den sanften Vorwurf fhlen und versprach, es auf einen Vers uch ankommen zu lassen. Nach wenigen Monaten behauptete Schulz, noch keinen solc hen Schler gesehen zu haben, und es entstand eine aufrichtige Freundschaft zwisch en Lehrer und Schler. In meinem dreiundzwanzigsten Jahre stellte mich mein Vater an, den Bau des Artil lerieschmieds Gricke als Polier[er] auszufhren. Er hatte mir dabei einen alten, ve rstndigen Gesellen namens Lorenz zur Hand gegeben. Nach Handwerksgebrauch verfert igte ich hier mein erstes Kreuzgewlbe mit alleinigen Hnden und wollte mir durchaus dabei nicht helfen lassen. Mit Zuziehung eines ganz rohen Lehrburschen ri ich mi
r die Lehrbogen vor, arbeitete sie sauber aus und stellte sie auf. Wie ich in di eser Arbeit begriffen war, sagte der Lorenz: Herr Polier[er], das geht nit! Ich an twortete: Wenn's nur steht! Er fuhr fort: Es steht auch nit! Nun, sagte ich, so wi h's tragen! Mein Gewlbe war geschlossen. Der Lehrbursche mute oben die Widerlager a usmauern, und ich ging unters Gewlbe und schlug die [240] Lehrbgen heraus. Mein Ge wlbe aber fiel mitsamt dem Lehrburschen so hart in den Keller, da ich beinah ersch lagen wurde. Indem ich mich aus den Trmmern hervorarbeitete, kam eben mein Vater gegangen, der ohne Verdru einige scherzhafte Worte zu Lorenz sprach und hinzusetz te: Lat ihn! Wer nichts baut, dem wird nichts einfallen! Mein Lehrbogen wurde sogle ich wieder aufgestellt. Den Fehler hatte ich bald eingesehen; das Gewlbe stand un d steht noch. Im Jahre 1782 ward in der St. Georgenkirche eine neue Orgel gebaut, und ich geda chte, zur Einweihung derselben eine neue Jubelmusik zu setzen. Kantor Schmidt un d der Organist Bhme machten groe Augen, da ein Mauergesell eine Kirchenmusik bauen wolle, und nahmen meinen Antrag kalt genug auf. Die Schwierigkeit, einen Text zu finden, der so gut gewesen wre, als meine Musik werden konnte, war bald berwunden. Ich fand einen schon einmal vom Kantor Khnau ko mponierten Text nicht zu schlecht, und was meine Komposition anlangte, so hoffte ich, hinter meinem Vorgnger nicht zurckzubleiben. Nach tausend Hindernissen, da mir niemand zu Hilfe kam, weil man nichts erwartet e, wurde meine Musik in der Kirche aufgefhrt. Mein guter Stadtpfeifer George umar mte mich vterlich entzckt und stellte mich seinen Leuten, die mich bisher wie eine n Bhnhasen ansahen, zum Muster dar. Der berhmte Marpurg kam aufs Orgelchor, legte seine Hand auf meine Achsel und munterte mich zum Fleie auf, indem er meine Keckh eit lobte. Ich durfte diesen Tag zu den glcklichen zhlen, denn anch Kantor Schmidt lud mich ein zu einem Schmause dieses Tages, wo mir der Ehrenplatz zwischen der Frau [241] Kantorin und einem artigen Mdchen angewiesen wurde. Was ich nun auch mochte geleistet haben, so hatte die Sache in ihrer Art Aufsehn gemacht, wenn au ch mein Vater keinen Anteil merken lie. Kirnberger lie mich zu sich kommen, verlan gte meine Musik zu sehen und schalt mich derb darber aus. Seine Schlerin, die Prin zessin Amalia, Schwester Friedrichs des Groen, lie mich rufen und verlangte, da ich auf ihrer Orgel spielen solle. Ohne Vorbereitung und Vorrede setzte ich mich hi n und spielte. Als ich lange noch nicht fertig war, sagte die Prinzessin: Hr Er man auf. Er kann ja nischt. Da reden die Menschen gleich von Genie! Das is ja nischt. Geh' Er man zu Kirnbergern, der wird Ihm schon sagen, wo's Ihm sitzt, denn was Er da macht, Wo mich nun diese gute Prinzessin hinschicken wollte, da is alles nischt nutze. war ich schon gewesen, und diese doppelte Demtigung wrde mich umgebracht haben, we nn ich vor Leichtsinn, Schchternheit und was sonst der Jugend beiwohnt, an etwas andres gedacht htte, als es besser zu machen. Auch war ich in der Tat nicht der Meinung, etwas Besonderes geleistet zu haben. Indessen wurde diese nmliche Musik bei anderer Gelegenheit, wozu Burmann einen an dren Text unterlegte, mehrmals wiederaufgefhrt. Hier hrte sie der schon genannte K apellmeister Schulz, der mir darber manches Belehrende sagte, was mich wieder erm unterte. Wenn ich ber diese ersten Versuche hier ausfhrlicher gewesen bin, als es eine Schlerarbeit verdient, so darf ich hinzusetzen, da ich ihn ganz vergessen htte , wenn nicht der sehr geschickte und bekannte Musikdirektor Schicht in Leipzig d iese Musik ohne mein Wissen sich anzuschaffen gewut htte, der sie mir [242] denn v or einigen Jahren bei meiner Anwesenheit in Leipzig, also nach vierzig Jahren, v orzeigte. Der nchste Vorteil, den ich nun von dieser Musik hatte, bestand darin, ein Ganzes angefertigt zu haben, dessen berblick mir die Einsicht gab, was mir fe hlte. Was ich bisher gemacht hatte, waren Sonaten, Sinfonien, Konzerte; Namen, d ie alle drei das nmliche aussagen, aber indem sie einer wandelbaren Observanz unt erliegen, keinen festen Begriff einer Form geben, ja spterhin Formlosigkeit als B edingung angenommen haben. Meine neue Orgelmusik war fr den hchsten Ort, fr das tie
fste Gefhl bestimmt, und da ich von meiner Mutter religis erzogen war, so fhlte ich hier zum ersten Male das Bedrfnis eines Stils. Da zu einem guten Stil eine gute Kunst gehre, die ich als Anfnger nicht besitzen ko nnte, war mir klar. So beschlo ich, zu einem Meister zu gehn und die Schule zu ma chen. Meine Wahl war bald getroffen. Sie fiel auf Fasch, den ich lngst im stillen vereh rte, ohne seine Arbeiten zu kennen. Zu diesem ging ich, brachte ihm einige meine r Arbeiten und bat um Unterricht. Er sah sie mit Ruhe durch und nahm mich an. Da er aber, wie viele andre, mich fr weiter hielt, als ich war, so wurde abermalen beliebt, da anzufangen, wo wir htten aufhren drfen; kurz, Fasch behandelte mich nic ht als einen Lehrling, sondern wie einen Dilettanten, was zu meinem grten Verdruss e viel zu spt von mir bemerkt wurde, wodurch sich denn endlich ein Widerwille geg en die Dilettanterei in mir ausbrtete, der mir in der Folge manchen Verdru gemacht hat. Allerdings war es seltsam, nicht fr das gelten zu wollen, wozu ich mich uerlich bek annte und dadurch [243] einen verfehlten Beruf zu erkennen gab. Fasch glaubte se inem Schler abraten zu mssen, die Musik als Bestimmung frs Leben zu ergreifen. Kirn berger tat das nmliche und pflegte dazuzusetzen: Wer uns nachfolgen will, der lern e erst sein Kreuz tragen! Das konnte jedoch mich nicht rhren, da ich eines guten H andwerks gewi war und meine Luft an der Musik in der Tat an Schmerz grenzte. Es w ar mir daher bitterer Ernst, das Hchste einer Kunst zu berkommen, mit der ich mein Tiefstes verwandt fhlte, und wenn mir alles merken lie, da mein Vaterland dafr kein Grund und Boden sei, so wollte ich ihn suchen und finden. Seit Jahr und Tag war ich in einem Hause gern gesehen, wo die lteste Tochter, ein ganz vorzgliches Mdchen, das Klavier spielte und eine sehr schne Stimme hatte. Die se, ob sie gleich einen Singlehrer hatte, wurde von mir nebenher auch im Singen unterrichtet und machte von nun an so bedeutende Fortschritte, da der gut bezahlt e Singlehrer, der zum berflu Bach hie, in groen Ruf kam. Ihre Schwester Janny beschft igte sich mit Malen, und mit dieser geriet ich bald in ein leidenschaftliches Ve rhltnis. Wir kamen berein, heimlich nach Italien zu gehen, wo sie ihrem Vorbilde, der berhmten Angelika, nahe sein, und ich das Land der Gesnge mit eigenem Munde kss en wollte.
Eines Sonntags sagte mein Vater mit ungewohnter Heiterkeit: Mein Sohn, morgen ist Quartalversammlung der Meisterschaft, und da sollst Du Dich melden, das Meister stck zu machen. Hieran war schon lange nicht mehr gedacht, und ich htte die Sache g ern fr Spa genommen, doch ich wute, da mein Vater, wenn er das Wrtchen soll aussprach, nicht spate. [244] Auf seine Rede wute ich daher nur zu sagen, da von meinem guten Willen alles , nur kein Meisterstck zu verlangen wre. Ich danke fr die gute Lehre, sagte mein Vate r; Du wirst Deine Schuldigkeit tun wie jeder andre. Man wird von Dir verlangen, w as billig ist, und wenn man Dich Meister heit, dann wirst Du anfangen zu lernen. Der Flei, die Notwendigkeit, die Verlegenheit, das sind die Lehrer, ohne welche e s keinen Meister gibt. Ich wei nur zu gut, da Du am liebsten Musik machst, und hab e Dich ungern darin stren wollen. Du bist jedoch alt genug, um einzusehn, da man n icht immer das Vaterhaus hat und den gedeckten Tisch, und da zum Leben noch mehr gehrt als Musik, Sonnenschein und dergleichen schne Sachen. Du mut ein Brger werden, ein Vater Deiner und anderer Kinder, und wenn diese leben sollen, so mut Du zu l eben haben. Meine Vaterpflicht ist es, Dich, meinen einzigen Sohn, so gut ich ka nn, in den Zustand zu versetzen, der Dich unabhngig macht und zum Herrn Deines Wi llens. Ein Maurermeister darf ein groer Knstler sein und Htten, Huser, Palste und Tem pel bauen, die man haben und bezahlen mu. Das wei ich, weil ich mich dabei immer w ohl und rechtfertig befunden habe. Musik, und was Ihr Herren Kunst nennt, ist ei ne schne Hoffnung. Hoffen ist kein Haben, und Haben kann nur durch Schaffen erlan gt werden, was freilich der Knstler auch kann; aber die Kunst ist lang, und leben
ist die erste Kunst, von der die anderen alle zehren. Wei ich doch, da hier wie be rall Ausnahmen sind von der Regel, denn groes Talent ist mchtig und lt sich nicht ge bieten. Es duldet lieber und leidet lieber, als da es von sich selber abliee, ein solches Talent kann ich in Dir nicht finden, und darum ist es besser, Du gehst m einen [245] Weg als einen solchen, den wir beide nicht kennen. Das Handwerk hat seine Stufen. Auf jeder kann man ehrlich stehen. Der unverdrossne Anfnger, der fe rtige Gesell, der kluge Polier[er], den Du anziehst und festhltst, diese machen D ich zum Meister. Ich kann wohl sagen: solchen Leuten bin ich manches schuldig wo rden. Kurz, ein wohlbekannter Handwerker ist immer besser daran als ein mittelmige s Talent, das die Kunst als Handwerk gebrauchen mu. Solche Vorstellungen wirkten um so mehr bei mir, da ich ein unermeliches Zutrauen zu meinem Vater und keine zu groe Meinung von meinem Talente hatte. Was mich dabei am verlegensten machte, war meine jetzige Lage. Mit Janny wollte ich nach Italien laufen, bei Fasch wollte ich den Kontrapunkt lernen, und auf ei n Handwerk, das ich nicht liebte, sollte ich Meister werden, wobei ich denn in G efahr war, mich zu prostituieren, indem ich das Meisterstck in knstlerischem Sinne nahm. Nun traute ich mir auch wohl zu wenig zu, wenn nicht meine angenommne Bes cheidenheit lngst entschiedne Unlust war. Ein Meistersohn, der nicht von der Natu r selber verlassen ist, hat von allen Seiten Gelegenheit, das Handwerk in sich a ufzunehmen, ohne es grade zu beobachten, um so mehr, wenn die Hausfrau Anteil ni mmt, wie es meine Mutter tat, ja die Bauten besuchte und meines Vaters Leute, we lchen von ihr ausgezahlt wurde, richtig beurteilte. Zu den Leiden, die sie mit m ir getragen hatte, erzhlte sie gern, da sie einmal von der Rstung gefallen sei, ind em sie mit mir schwanger war, und da ich zu einem Maurer mte geboren sein. Daneben hatte sie schon frher achtzehn Jahre hindurch zwei Ziegeleien, welche mein Vater gepachtet hatte, fnf Meilen von [246] Berlin, die eine Stunde weit auseinander la gen, mit einer Sicherheit bewirtschaftet, deren sich ein Mann htte rhmen drfen, des sen einziges Geschft es gewesen wre, gegen zweihundert Arbeiter anzustellen und zu beaufsichtigen. Als Beleg ihres Benehmens in diesem Geschfte mge folgender Vorfall dienen: Friedri ch der Groe lie gleich nach dem Siebenjhrigen Kriege besonders in Potsdam so eifrig bauen, da die Ziegeleien kaum so viele Steine beschaffen konnten. Darber wurden d ie Arbeiter aufsssig und forderten greren Lohn. An einem Sonntage in Abwesenheit me ines Vaters versammelten sich unsre Arbeiter an der Ziegelei vor dem Hause, stel lten sich im Halbkreise auf, und sangen, mit ihren Stcken zeigend, in hundertstim migem Unisono: Will se woll Lohn toleggn! Will se woll Lohn toleggn! unter unaufhrl ichem Da Capo. Indem sie sich nun einstweilen zu erholen schienen, trat meine Mutter, eine hoch gewachsne Frauengestalt, mitten unter sie: Ihr guten Mnner (die Weiber hatten sich gleich hinter ihren Mnnern gelagert), es ist heute Sonntag. Ihr wit, da ich euer mehr als je bentigt bin und nie verlangt habe, den Sonntag durch Arbeit zu entheiligen, die ich euch gern vergtete. Nun legt ihr euch selber die saure Arbeit auf, hier zu musizieren, und habt nichts dafr als d ie schnde Freude, mich zu ngstigen, die ich verlassen unter euch stehe und nur den unmndigen Sohn neben mir habe. Mchtet ihr nur bedenken, wie es euch gefiele, wenn sich ein Mann so gegen eine eurer Frauen ausliee, und euer sind so viele gegen e ine! Ihr sollt aber nicht fehlgegangen sein. Wir sind in den lngsten [247] Tagen, und wenn ihr morgens eine Stunde frher anfangt und abends eine Stunde lnger arbei tet, Sonntags vormittag in der Kirche eure Andacht verrichtet und nachmittag, st att auf der Kegelbahn die Zeit mit Trinken vertut, so tut ihr euch und mir wohl, und mein Mann wird euch gewi lohnen. Dat lett sick heren! rief einer. Sie traten in Gruppen, berieten sich, Betrunkne w urden entfernt und die Ruhe hergestellt. Als mein Vater von Berlin zurckkam, erzhl te ihm der Ziegelmeister die Geschichte und setzte hinzu: Herr Zelter! siene Fru,
dat is en Mann! De verstaht den Rummel! Sie konnte nur Gedrucktes lesen. Von ihrer Mutter selber war sie abgehalten word en, schreiben zu lernen, weil es fr unntzlich, ja fr schdlich gehalten wurde, da ein Mdchen schreiben knne. Hierber war sie in ihrer jetzigen Lage sehr traurig. Ja, wenn ich schreiben knnte! seufzte sie oft, indem sie ihre Kinder glcklich pries. Mein V ater, der als ein Sachse eine sehr schne Hand schrieb, wute diesem Mangel dadurch abzuhelfen, da er alles mit Fraktur schrieb, welches die Mutter lesen konnte, was jedoch nicht berall ausreichte. Darber wurde ich denn angehalten, ihr in allen di esen Dingen beizustehn. Mein lterer Bruder, der frhzeitig gestorben war, wurde von meiner Mutter tief betrauert. Wenn sie Sonntags mit uns zur Kirche ging, betete sie an seinem Grabe, und es schien, da dieser Johann, wenn er gelebt htte, der So hn ihres Herzens gewesen wre. Eines Abends, ich mochte fnfzehn Jahre alt sein, kam ein Geschftsbrief, der mit Un geduld erwartet war. Mein Vater war verreiset, der Brief mute erbrochen und beant wortet werden. O mein Hannchen! rief meine Mutter [248] in bittern Trnen, wenn du nu r lebtest, du httest mich lngst schreiben gelehrt! Ich war tief bewegt und erbot mi ch, sie zu unterrichten, so gut es mir mglich sein wrde. Es wurde sogleich ein Anfang gemacht, und nach wenigen Wochen fand sich mein Vat er durch einen Brief von der Hand seiner Gattin berrascht, der einen ausfhrlichen Bericht ber den Geschftsgang der Ziegeleiangelegenheit enthielt. Meine Belohnung b estand in dem Ausspruche meines Vaters, da dies das erste Gute sei, was ich mein Lebelang getan. Meine Mutter aber beschenkte mich mit einem Friedrichsdor, eine fr sie und mich unendliche Summe, die ich mir zu Pfennigen berechnete. Wenn ich bisher die Zrtlichkeit meiner Mutter mit einem abgeschiednen Bruder teil en mssen, den ich kaum gekannt hatte, so ward ich von jetzt an mit einer Art von Respekt angesehen, dessen ich mich so wenig schmte, da ich in der Tat fleiiger wurd e, um die Aufmerksamkeit meiner Mutter gegen den jungen Lehrer zu rechtfertigen. Wiederholtes Hin- und Herreisen zu den Ziegeleien, Holzablagen, Stadt- und Landb auten verursachten gleichfalls rhrige Bewegung, die das ganze Haus in Anspruch na hm und in die Erziehung berging, woher mir denn dies Geschftswesen nicht fremd sei n konnte. Jetzt war ich im vierundzwanzigsten Jahre, und wenn ich seit sechs Jahren zu eif rig Musik getrieben hatte, so tat ich doch auch aus Gehorsam, wozu ich angehalte n wurde. Ich hatte die Anschlge zu berechnen, die Rechnungen in die Hauptbcher ein zutragen, auszuheben und Konzepte zu mundieren. Im Zeichnen war ich wohl imstand e, [249] einen Grundri zu disponieren, ein Profil zu machen und dergleichen. Etwa s Geometrie, Mechanik und Statik war auch vorhanden. Was ich las, verstand ich; was ich wute, konnte ich nach meiner Art aufschreiben; ein Mauerwerk aufnehmen, e in Haus taxieren, und was sonst tglich vorkam. Das alles lag in mir wunderlich du rcheinander und wartete auf Gelegenheit. Gemauert hatte ich vier Sommer hindurch , was nicht zu viel ist, doch hatte ich die verschiedenen Verbnde der Mauergewlbe und Dacharbeiten eigenhndig versucht, unsre besten Arbeiter dabei beobachtet und nach Art junger Leute alles kindisch leicht befunden. Dies wute mein Vater, wenn ich es mir auch nicht anrechnete. Was mir fehlte, konn te ich erfragen, wie ich es brauchte; und so bestand er auf seinem Sinne, indem er mich nur in Zug zu bringen suchte. Ein Entschlu mute gefat werden, und ich fgte m ich in meines Vaters Willen. Ein besonderer Umstand, der wohl anderen verdrielich gewesen wre, war mir dabei fa st willkommen und unvermutlich frderlich obenein. Mit mir zugleich meldete sich n och ein Gesell zum Meisterwerden, der mir darum vorgezogen wurde, weil er das Ge werk wegen Hindernisse beklagt hatte und auf hhern Befehl ins Stck gesetzt werden mute, zumal ich auch noch nicht ganz volljhrig war.
Der Mann konnte fr einen guten Maurer gelten, doch im Rechnen und Zeichnen war er nicht empfohlen. Fast schien es, als wenn er nur zum Stcke gelassen wre, um mich dadurch ein Jahr lnger aufzuhalten, womit ich keinesweges unzufrieden war, indem ich die offne Welt vor mir hatte. Da ich ihn htte beneiden sollen, [250] so traut e er mir nicht, und so ging man eine Zeitlang aneinander vorber. Er hatte das Papier, worauf seine Aufgaben sollten zu stehen kommen, auf ein Zei chenbrett gespannt. Es hatte aber groe Falten, da es unmglich war, eine reine Horiz ontallinie zu ziehen. In dieser Verlegenheit klagte er sein Papier an, und ich l ie mich willig finden, ihm ein anderes aufzuspannen, das vollkommen anschlo. Nun k lagte er ber Augenschwche. Dadurch bekam ich seine Aufgaben zu Gesichte, und indem ich ihn ausfragte, was er daraus zu machen gedchte, erkannte ich meine berlegenhe it, und da die Sache nicht von der Gefahr sei, die ich mir dabei vorgestellt hatt e. Ich untersttzte ihn mit Rat und Tat, und da niemandem einfiel, da ich ihm gnstig sein knne, so ward es anfnglich nicht bemerkt und ich der Vertraute seines Unvermg ens. Da man ihm aber nicht zutraute, was er, zustande brachte, so wurde er eine Zeitlang so scharf beaufsichtiget, da er den Mut verlor und seine Untchtigkeit bek annte. Er wurde zurckgewiesen, und ob ich gleich keinen weiteren Verkehr mit ihm hatte, so ist er mir doch bis an seinen Tod als ein verbindlicher Freund erschie nen, ohne den Vorteil zu ahnen, den ich selber davon hatte. Ich war nmlich dreist geworden, und meine ihm gewhrte Hilfe war mir eine Vorbereitung, die ich kaum gns tiger wnschen konnte. Meine Aufgaben waren so beschaffen, da ich mit dem, was ich aus dem Vignola und P enther und Vitruv wute, vollkommen ausreichte und mir nebenher ganz ohne Sorgen n och mit Notenschreiben und Abendmusiken die Zeit vertrieb. Auch mein Vater wunde rte sich, da ich ihn um nichts befragte, wozu mich die Mutter hinlnglich [251] erm ahnte. Ich war keck genug, diese Hilfe nicht zu suchen. Nach zwei Monaten wurden meine Arbeiten abgeliefert. Wegen einiger Versehen und Nachlssigkeiten dabei ward ich vom Gewerke zu einer leichten Geldbue gezogen. Ein bedeutendes Landhaus vor der Stadt, woran ich mich praktisch ausweisen sollte, w ar bereits angefangen, und binnen neun Monaten war ich auch hiermit so weit, da n ach einem beschlieenden mndlichen Examen des Kniglichen Schlobaumeisters Naumann, wo bei ich ber meine eigne Erwartung zurechtkam, meine Probezeit als bestanden anges ehen wurde. Mit meinem fnfundzwanzigsten Jahre ward ich nun am 1. Dezember des Jahres 1783 or dentlich zum Meister gesprochen, und wenn ich bedachte, was ich mir in Jahresfri st abgewonnen hatte, so durfte ich ohne Unbescheidenheit etwas auf mich halten. Ich hatte mich zusammengenommen und durch Aufmerksamkeit in kurzem erstanden, wo zu ich mir wohl die Kenntnis, doch nicht die Fertigkeit zutraute. In elf Monaten hatte ich die smtlichen Grundrisse, Hauptfassade und Profil zu ein em frstlichen Schlosse von 800 Fu Front, von drei Geschossen korinthischer Ordnung , worin eine Kirche, ein Theater, und was sonst dazu gehrt, nach meiner Art, doch bestimmt und reinlich gezeichnet, veranschlagt und endlich ein ganz massives La ndhaus von drei Geschossen, 110 Fu lang und 42 Fu tief mit Gewlben und smtlichen Feu erungen roh bis unter das Dach geliefert. Dabei hatte ich nicht einmal meine kon trapunktischen Studien versumt; kurz ich war anerkannter Brger und Maurermeister, und wenn's wre verlangt worden, htte ich mich wohl noch als [252] Musik- oder Kape llmeister einer viel strengeren Prfung unterworfen, indem ich mehre[re], Konzerte dirigierte, als Komponist nicht ungnstig angesehen war, und auf drei verschiedne n Instrumenten Konzerte spielte. War nun mein Vater hoch vergngt, sein eingerichtetes Geschft mit Haus und Hof sein em Sohne bei Leib und Leben zu vererben, um daran noch einmal sich seiner eigene n Jugend zu freuen, so fhlte der Sohn sich eben jetzt um so weniger glcklich.
Janny, welche sich schon seit einiger Zeit in Briefen zurckziehend erwiesen hatte , erklrte nun, da ich sie zur Meinigen machen durfte, mit umwundnen Worten, da sie es nicht werden knnte, und das brachte mich fast zur Verzweiflung. Sie war im neunzehnten Jahr, und ohne eine Schnheit zu sein, ein gesundes Mdchen v on entschiednen Geistesgaben. Auer dem, was sie im Zeichnen und Malen leistete, s prach und schrieb sie vier Sprachen rund und natrlich, und da sie mich als ein ro hes Naturkind beliebt und wert gehalten, liebte ich sie ber Maen, weil ich wohl be merkte, wie sie seit zwei Jahren auf mein ueres und Inneres gewirkt hatte. Auch wa r sie dem Vertrauen auf mich so ergeben gewesen, da wir halbe Nchte allein beieina nder waren, und ich wei kaum, wie es zuging, da nicht das Letzte von uns gewagt wu rde. Was mich am tiefsten schmerzte, war, da ich glaubte, sie gekrnkt zu haben, und dam it hatte es folgende Bewandtnis: In einem Hause, wo es so gastlich herging und zwei anmutige Tchter sich mit Kunst beschftigten, konnte es nicht an Gsten fehlen, wie ich denn hier mit Ramler, [253 ] Engel, Mendelssohn, Rode, Frisch, Leuchsenring, Chodowiecki, Stamford, Schulz, Reichardt und mehrern werten Menschen in nhere Berhrung kam. Da nun aber, was man Musik nennt, in guten Husern zu den gesellschaftlichen Spiel en gerechnet wird, so mute ich mit Wehmut bemerken, da man nur allein die zeichnen den Knste fr Kunst gelten, mich jedoch als Musikliebhaber nur so mitlaufen lassen und keineswegs so viel zugeben wollte, als man sich selbst herausnahm. Eines Abe nds fate ich das Herz, mit meiner Sprache herauszurcken und zu behaupten, es gebe nur eine Kunst, und was man Knste in der Mehrheit nenne, seien nur Zweige dieser einen Kunst. Ein Zweig aber sei kein Baum, und nur ausgemachte Philisterei knne e ine Klassifikation anerkennen, nach welcher einer dieser Zweige ber dem anderen e rhaben sei; wie denn das ganze Altertum die Musen Schwestern nenne, von denen ke ine die herrschende sei, indem sie alle von einem Gotte beherrscht wrden. Die Kun st an sich sei aber eine angeborne Wirkung geistigen Triebes im ganzen Menscheng eschlechte, sich nach unendlichen Richtungen auszubilden und durch Nachahmung de r Natur seine Verwandtschaft damit und seine Sehnsucht nach dem Unendlichen zu u nterhalten. Nur in diesem Sinne sei Kunst und Wissenschaft eines ausschlielichen Bestrebens wrdig; woraus endlich das Kunstwerk als ein drittes noch Unbekanntes h ervorgehe, das immer den Namen des Knstlers tragen mge wie das Kind den Namen des Vaters. Wenn ich mich damals anders mag ausgedrckt haben wie hier, so mag dies wie noch h eute der Sinn meiner Worte gewesen sein, welche vielleicht noch derber, ja unges chickt mgen herausgekommen sein; denn ich nannte [254] die meisten Knstler Abschre iber, die ein miges Handwerk trieben, das keinem zugute komme. Hier war ich nun garstig angelaufen. Vier oder fnf junge Maler, die mich bis jetz t wie ein stehendes Wasser betrachtet hatten, fielen mich zugleich an, und da Ja nny von ihrer Profession war, so kamen sechs ber einen. Was hier ins Blaue gerede t worden, soll vergessen sein; ich war zufrieden, mein beladenes Herz ausgeschtte t zu haben. Die Wirkung meiner Rede aber brachte mir eine khle Gute Nacht zuwege, u nd ich hatte eine sehr schlechte Nacht. Als ein empfindsamer Liebhaber war ich schon von mancherlei Vorzeichen befangen, die sich jetzt erst belebten. Janny hatte mich mit dem schnsten Hndchen beschenkt , das ich mir zuziehen wollte. Es hatte mir einen von Jannys Briefen, die parfmie rt waren, bis aufs Siegel aufgegessen, und ich hatte es grausam dafr bestraft. Me in Tasto ward darauf so krank, da ich mit ihm zu einem Tierarzt gehen mute, und da s war der Scharfrichter Brand, den ich schon kannte. Der Mann verlangte, da ich i hm den Hund dalassen sollte; dagegen verlangte ich, da der Arzt den Patienten bes uchen sollte, wofr ich ihn anstndig honorieren wrde. Endlich erklrte Brand, er drfe d as Tier nicht wieder zurck in die Stadt lassen; der Hund habe den Rotz, und er al
s Arzt sei verantwortlich, weil diese Krankheit eine ansteckende Seuche sei; auc h werde es schwer sein, den Hund durchzubringen; er werde kaum morgen erleben. A ls er dies sagte, geriet ich in die traurigste Leidenschaft; meine Trnen flossen und rissen den guten alten Mann so mit sich, da er alles andere verga und in Trnen ausrief: Ja, ja, ich wei, was das sagen will! Habe ich doch auch vor [255] kurzem ein geliebtes Tchterchen dem Tode hingeben mssen! So stand ich denn wieder allein und wute kaum, was ich mit meiner neuen Meistersc haft beginnen sollte, denn mein Herz war in seinen Tiefen verletzt. Die Stadtpfeiferei hatte ich lngst verlassen und mich mit Kniglichen Kapellmeister n bekannt gemacht. Einige Kompositionen, von denen die Wielandsche Kantate Serafi na und andere Stcke im Korsicaschen Konzerte waren gehrt worden, fanden Beifall; da durch wurde ich mit der Kniglichen Sngerin Maria Eichner bekannt, welche mir Geleg enheit gab, den Konzerten des damaligen Kronprinzen, nachherigen Knigs Friedrich Wilhelms II. in Potsdam beiwohnen zu drfen. Hier hrte ich zum ersten Male Hndels Mes sias. Niemals hatte ich bei der Musik etwas hnliches empfunden. Da ich von Jugend an von meiner Mutter war zum Bibellesen angehalten worden, so ward mir der Text wie mit einem Schlage gegenwrtig und Hndels Musik eine erschpfende Paraphrase jedes Worts; alles zusammen aber meiner Empfindung des lutherischen Christentums so a ufgepat, so damit zusammenflieend, da meine Freude in lauten, ja in schmerzlichen uer ungen ausbrach und Aufmerksamkeit erregte. Man glaubte, mir sei nicht wohl, und der Kronprinz lie fragen, was mir fehle. Nach Endigung der Musik, welche bis neun Uhr gewhrt hatte, schlich ich mich schamhaft fort, lief in der Nacht zu Fue nach Berlin und benetzte den einsamen Weg mit Trnen der Rhrung. Andren Tages schrieb ich an die Freundin Eichner, bei der ich zu wohnen pflegte, entschuldigte mein Betragen und meine Entweichung so gut ich konnte, worauf ich [256] denn vom Kronprinzen selber die Erlaubnis erhielt, allen seinen Sonntagsk onzerten beizuwohnen. Die Zeugnisse, welche mir durch die Revision meiner Meisterausarbeitungen von se iten des Kniglichen Oberbaudepartements erteilt waren, hatten ihre guten Folgen. Man gab mir sogleich einen Kniglichen Bau, und einige Brger wollten ihre Huser von dem angehenden Meister gebaut haben; dazu die ausgebreitete Kundschaft meines Va ters, dies zusammen erforderte meine ganze Ttigkeit, und es wurde hbsches Geld ver dient, wovon ich leider keinen Gebrauch zu machen wute, da ich wenig brauchte und nichts zu versorgen hatte. Mein Vater freute sich meines Fleies; das heit, ich war arbeitsam, wiewohl ohne ei gentlichen Anteil. Mein Herz war zerrissen; so dmmerte ich fort, und da ich jetzt zur Musik noch weniger Zeit als Trieb hatte, so wurde ich nicht gestrt, mein Ges chft zu verfolgen. So setzte sich nach und nach die Meinung in mir fest, da ich wo hl ein guter Musikus wie andere werden knne, doch kein Produktionstalent habe, wi e sich's nachher deutlich genug gezeigt hatte. Nun war ich sechsundzwanzig Jahr alt, als meine Mutter fast tdlich vom Schlage ge troffen wurde. Dieser Unfall wirkte stockend auf das Hauswesen, denn der Faden d es ganzen Geschfts ging durch ihre Hand, aus der die eingegangnen Geldsummen sich in die kleinsten Portionen zerlegten. Dies Geschft ging nun auf mich ber, dem es traurig, ja ttend vorkam, indem ich zum Festhalten eingegangnen Geldes, wie auch mein Vater, nicht Geschick genug hatte. Dieser, dem der Trieb zur Geschftigkeit be r alles ging, schien nur Freude zu haben am Gelde, wenn er es wieder loswerden k onnte, [257] wie er denn als ein glcklicher Lottospieler selten ganz leer ausging und das Gewonnene ohne Wissen meiner Mutter guten drftigen Leuten zuwandte. Eine m Freunde, der ihn darber zur Rede setzte, antwortete er: Ich bin kein Spieler. Wa s ich brauche, verdiene ich. Und wenn ich missen kann, was ich verliere, so kann ich getrost verschenken, was ich gewinne. Im Jahre 1786 am 17. August starb Friedrich II. Auf das Gedchtnis dieses groen Knig
s setzte ich eine Musik, welche zuerst in der Garnisonkirche aufgefhrt und kurz n achher in verschiednen Konzerten wiederholt wurde. Auf diese Musik wendete ich n ach langer Ruhe den besten Flei. Was mir dabei ber alles ging, war, da mein Vater s ie hatte hren wollen und davon war gerhrt worden. Er erzhlte mir nachher, da er zwis chen dem Professor Engel und dem Geheimen Rat Hymmen, beides gute Musikkenner, i n der Mitte gesessen und sich unerkannt an dem redlichen Beifall dieser Mnner nic ht weniger als an der Musik selber erbaut habe. Und nun war ich zum ersten Male mit mir selber zufrieden, weil mein Vater es zu sein schien, der bisher meine musikalischen Bemhungen mit Gleichgltigkeit an sich vorbergehn lie. Diese Landesbegebenheit und der vorauszusehende Tod meiner Mutter wirkten nieder schlagend auf meinen Vater, dessen sonstige Munterkeit in ein totenhaftes Wesen b erging. Da meine Mutter schwer daniederlag und meine beiden Schwestern verheirat et waren, so bestand unser Mittagstisch aus zwei Personen von gleichen Leiden, u nd die Unterhaltung mute, wo nicht traurig, doch mager ausfallen. An einem Sonnta ge (meine Schwester Luise und mein Schwager Syring waren [258] mit zu Tische) er hob sich mein Vater zu einer lang vermiten Heiterkeit; seine Augen strahlten, als ob sie die Decke durchschauten. Er hatte vom besten Weine geben lassen und mit der Hand am Glase sprach er: Meine Kinder! Ihr seht, es geht zu Ende; wir werden nicht lange mehr beisammen sein. Eure Mutter ist nicht zu retten, und was mich a n meine Jahre erinnert, ist des groen Knigs Tod. Ihr bleibt nach uns zurck, doch se inesgleichen werdet ihr nicht wieder sehen. Er war mein stetes Vorbild; so wie e r Knig war seines Landes, so suchte ich Herr meines Hauses, meines Willens und me iner Ttigkeit zu sein. Sie haben ihn gescholten ber Kaffee, Tabak und tausend entb ehrliche Bedrfnisse, und ber zehntausend notwendige Dinge werden sie ihn bald genu g vermissen. Mir in meiner kleinen Enge geschah das hnliche; meine Leute waren un zufrieden in guter Zeit, wenn alles frisch von dannen gehn und ich sie haben mute , kaum war ihnen etwas gut genug. Doch im Winter hatten sie Holz und Brot, weil ich es immer einzurichten suchte, da die, welche an mich glaubten, keine Not habe n sollten. So wird der Winter kommen ber dies Land, das einen langen Sommer verke nnt; und der unselige Kaffee, um dessentwillen sie ihn schalten, wird die Eingew eide der Lnder zerreien. Das sollt ihr euch merken, da ich's gesagt habe, und dabei eurer Vter gedenken. Nur habe ich die Bitte an Dich, mein einziger Sohn: verla Deinen Vater nicht im A lter! Ich bin's nicht gewohnt, allein zu sein; Du sollst es nirgend in der Welt besser finden als hier. Ich bin aus der Fremde und wei, was ich hier gefunden hab e und lasse. Dein Verlangen, andre Lnder zu sehn, ist mir wohl bewut; aber verla mi ch nicht nach dem Tode Deiner Mutter! [259] Dies versprach ich; doch wider Vermuten fgte sich alles anders. Am 25. Janu ar nach Friedrichs Tode starb mein Vater fast pltzlich, und nun war ich mit meine r kranken Mutter allein, die ich aus einem Bette ins andre trug, weil sie sich v on niemand andrem gern angreifen lie. Es ward ein neuer Plan entworfen, demzufolg e ich nach dem Tode meiner Mutter was mein war, verkaufen und nach Italien gehen wollte. Meine nchsten musikalischen Arbeiten waren Konzerte und Sonaten fr das Klavier, di e Violine und Bratsche, um mich als brauchbaren Musikus ausweisen zu knnen. In It alien dachte ich mich in Singstcken zu versuchen, wie ich mich schon hier in ital ienischen Opern der Metastasio, Landi und Sanseverino gebt hatte. Der hilflose Zu stand meiner Mutter, deren einziger Trost ihr Sohn war, verzgerte sich siebzehn J ahre nach meines Vaters Tode. Um ihr eine Freundin und Vertraute zu geben, verhe iratete ich mich im Jahre 1787 mit einer Witwe, der Tochter des Frsters Kappel, d ie ich liebte, weil sie von meiner Mutter geliebt wurde. Und als meine Mutter di e Welt verlie, war ich schon zum zweiten Male seit dem 1. Mai des Jahres 1796 mit der jngsten Tochter des Geheimen Finanzrates Pappritz verheiratet und hatte ein rundes Dutzend gesunder Kinder. Von hier an lebte ich mein brgerliches Leben ruhi
g fort, und da meine zweite Frau eine edle Sngerin war, so bestanden jetzt die me isten meiner Kompositionen in Singstcken fr ihre schne Stimme. Mit vorzglichen Musikern war ich in knstlerische Verhltnisse gekommen; ich nahm Ant eil an periodischen Kunstschriften. Nebenher unterwies ich im Singen und in der Lehre vom Grundbasse, um mich selbst darin mehr und mehr zu befestigen.
También podría gustarte
- Forderungsmanagement durch Inkassounternehmen und Erstattungsfähigkeit von InkassokostenDe EverandForderungsmanagement durch Inkassounternehmen und Erstattungsfähigkeit von InkassokostenAún no hay calificaciones
- Chopin vs. Liszt - Zwischen Freundschaft und Rivalität: Biographien von Franz Liszt und Frédéric ChopinDe EverandChopin vs. Liszt - Zwischen Freundschaft und Rivalität: Biographien von Franz Liszt und Frédéric ChopinAún no hay calificaciones
- Benjamin Franklins Leben, von ihm selbst beschrieben: Die AutobiografieDe EverandBenjamin Franklins Leben, von ihm selbst beschrieben: Die AutobiografieAún no hay calificaciones
- Stufen: Eine Entwickelung in Aphorismen und Tagebuch-NotizenDe EverandStufen: Eine Entwickelung in Aphorismen und Tagebuch-NotizenAún no hay calificaciones
- Goethes Werther und Lottes Leiden: Realität versus dichterische FreiheitDe EverandGoethes Werther und Lottes Leiden: Realität versus dichterische FreiheitAún no hay calificaciones
- Kleine Erzählungen und Nachgelassene Schriften 1De EverandKleine Erzählungen und Nachgelassene Schriften 1Aún no hay calificaciones
- Schwinge wird, was Schwere war: Gustav Schüler. Leben und WerkDe EverandSchwinge wird, was Schwere war: Gustav Schüler. Leben und WerkAún no hay calificaciones
- Eine Chronik aus dem 20.ten Jahrhundert: Tagesnotizen, Briefe, Erinnerungen ab 1933De EverandEine Chronik aus dem 20.ten Jahrhundert: Tagesnotizen, Briefe, Erinnerungen ab 1933Aún no hay calificaciones
- Autorenabende mit Hermann Hesse: Eine DokumentationDe EverandAutorenabende mit Hermann Hesse: Eine DokumentationAún no hay calificaciones
- Liebesbriefe aus alter Zeit: Emmi und Franz. Eine böhmische LiebesgeschichteDe EverandLiebesbriefe aus alter Zeit: Emmi und Franz. Eine böhmische LiebesgeschichteAún no hay calificaciones
- Deutsche Menschen: Das Buch versammelt 27 Briefe aus den hundert Jahren zwischen 1783 und 1883, von der Französischen Revolution bis zur GründerzeitDe EverandDeutsche Menschen: Das Buch versammelt 27 Briefe aus den hundert Jahren zwischen 1783 und 1883, von der Französischen Revolution bis zur GründerzeitAún no hay calificaciones
- Walter Benjamin: Deutsche Menschen: Das Buch versammelt 27 Briefe aus den hundert Jahren zwischen 1783 und 1883, von der Französischen Revolution bis zur GründerzeitDe EverandWalter Benjamin: Deutsche Menschen: Das Buch versammelt 27 Briefe aus den hundert Jahren zwischen 1783 und 1883, von der Französischen Revolution bis zur GründerzeitAún no hay calificaciones
- "... kehrte ich bei Hempel ein": Auf den Spuren bekannter und unbekannter Autoren in OranienburgDe Everand"... kehrte ich bei Hempel ein": Auf den Spuren bekannter und unbekannter Autoren in OranienburgAún no hay calificaciones
- Hermann Menge: Vom Gymnasialdirektor zum BibelübersetzerDe EverandHermann Menge: Vom Gymnasialdirektor zum BibelübersetzerAún no hay calificaciones
- Eine deutsche Pfarrfrau: Blätter der ErinnerungDe EverandEine deutsche Pfarrfrau: Blätter der ErinnerungAún no hay calificaciones
- Die intellektuale Anschauung der Freundschaft: Friedrich Schlegel und Novalis im Spiegel ihres BriefwechselsDe EverandDie intellektuale Anschauung der Freundschaft: Friedrich Schlegel und Novalis im Spiegel ihres BriefwechselsAún no hay calificaciones
- Sherlock Holmes und das Geheimnis von MayerlingDe EverandSherlock Holmes und das Geheimnis von MayerlingAún no hay calificaciones
- Lebensbeschreibung des k. k. Kapellmeisters Wolfgang Amadeus MozartDe EverandLebensbeschreibung des k. k. Kapellmeisters Wolfgang Amadeus MozartAún no hay calificaciones
- "Huch, ein Kritiker!": Leben und Lieben eines Wiener Journalisten in KölnDe Everand"Huch, ein Kritiker!": Leben und Lieben eines Wiener Journalisten in KölnAún no hay calificaciones
- Eine Welt auf sechzehn Saiten: Gespräche mit dem Vogler QuartettDe EverandEine Welt auf sechzehn Saiten: Gespräche mit dem Vogler QuartettAún no hay calificaciones
- "Da lag er vor uns, der buchtenreiche See ...": Auf den Spuren bekannter und unbekannter Autoren in Oberhavel Fürstenberg, Gransee, Zehdenick, Löwenberger Land, KremmenDe Everand"Da lag er vor uns, der buchtenreiche See ...": Auf den Spuren bekannter und unbekannter Autoren in Oberhavel Fürstenberg, Gransee, Zehdenick, Löwenberger Land, KremmenAún no hay calificaciones
- Die Gred - Historischer Roman aus dem alten Nürnberg: Mittelalter-RomanDe EverandDie Gred - Historischer Roman aus dem alten Nürnberg: Mittelalter-RomanAún no hay calificaciones
- SCHILLER - Lebensgeschichte in 6 Bänden: Eine romanhafte BiografieDe EverandSCHILLER - Lebensgeschichte in 6 Bänden: Eine romanhafte BiografieAún no hay calificaciones
- Vom Kriegsende bis nach der Wende - So war es damalsDe EverandVom Kriegsende bis nach der Wende - So war es damalsAún no hay calificaciones
- ... am allerliebsten ist mir eine gewisse Herzensbildung: Die InterviewsDe Everand... am allerliebsten ist mir eine gewisse Herzensbildung: Die InterviewsAún no hay calificaciones
- Six Diverses Pieces de La Vie de Schulz Et WeyseDocumento44 páginasSix Diverses Pieces de La Vie de Schulz Et WeyseMichael KämmleAún no hay calificaciones
- Der arme Mann im Tockenburg: Lebensgeschichte und Natürliche Ebentheuer des Armen Mannes im TockenburgDe EverandDer arme Mann im Tockenburg: Lebensgeschichte und Natürliche Ebentheuer des Armen Mannes im TockenburgAún no hay calificaciones
- Begegnung Mit Östlichem Denken: Hermann Hesse Und Richard Wilhelm (Vortrag)Documento24 páginasBegegnung Mit Östlichem Denken: Hermann Hesse Und Richard Wilhelm (Vortrag)merlin66Aún no hay calificaciones
- Der Dichter Paul Fleming Und Seine Beziehungen Zu RevalDocumento30 páginasDer Dichter Paul Fleming Und Seine Beziehungen Zu RevalrenpeAún no hay calificaciones
- StufenEine Entwickelung in Aphorismen Und Tagebuch-Notizen by Morgenstern, Christian, 1871-1914Documento131 páginasStufenEine Entwickelung in Aphorismen Und Tagebuch-Notizen by Morgenstern, Christian, 1871-1914Gutenberg.orgAún no hay calificaciones
- Christian Friedrich Daniel SchubartDocumento18 páginasChristian Friedrich Daniel SchubartGerald HambitzerAún no hay calificaciones
- August Klughardt - Sein Leben Und Seine WerkeDocumento182 páginasAugust Klughardt - Sein Leben Und Seine WerkeJustin MorganAún no hay calificaciones
- SonderwegeDocumento107 páginasSonderwegeKassák MúzeumAún no hay calificaciones
- Die Toteninsel - WikipediaDocumento14 páginasDie Toteninsel - WikipediarhjwillAún no hay calificaciones
- Kätzchen Häkelanleitung: Design by Yuliya AlbunDocumento16 páginasKätzchen Häkelanleitung: Design by Yuliya Albunyekaterina56Aún no hay calificaciones
- Steff La Cheffe - Ha Ke Ahnig (Alle AB)Documento19 páginasSteff La Cheffe - Ha Ke Ahnig (Alle AB)Giulia RosannaAún no hay calificaciones
- Felsbilder Externsteine PDFDocumento2 páginasFelsbilder Externsteine PDFScottAún no hay calificaciones
- House Near BadalingDocumento3 páginasHouse Near Badalingsectiune79Aún no hay calificaciones
- Buch EndfertigungDocumento18 páginasBuch EndfertigungSorin PaunescuAún no hay calificaciones
- Das Laboratorium Der Gefühle: Georg Friedrich Händels AlcinaDocumento9 páginasDas Laboratorium Der Gefühle: Georg Friedrich Händels AlcinaElisabeth von LeliwaAún no hay calificaciones
- Verständigung Stelle Besetzt - 20210819103038260Documento1 páginaVerständigung Stelle Besetzt - 20210819103038260Telina AlexandraAún no hay calificaciones
- Die Gruppe 47 Als Die Deutsche Literatur Geschichte Schrieb (Helmut Böttiger)Documento459 páginasDie Gruppe 47 Als Die Deutsche Literatur Geschichte Schrieb (Helmut Böttiger)InfoDeutsch VnAún no hay calificaciones
- Altuglas Cast Sheet OptimizedDocumento82 páginasAltuglas Cast Sheet OptimizedTatjana Rajak Ex IlicicAún no hay calificaciones